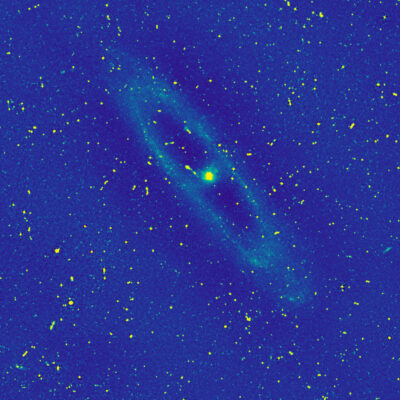Barrieren abbauen und eine gerechtere Medizin für alle verwirklichen – das sind Ziele der Medizinischen Fakultät OWL der Universität Bielefeld. Mit dem Forschungsprofil „Medizin für Menschen mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen“ sollen Benachteiligungen identifiziert und angehende Ärzt*innen schon im Studium für inklusive Medizin sensibilisiert werden.
In Deutschland leben mehr als 13 Millionen Menschen mit einer Beeinträchtigung. Eine große und heterogene Gruppe, die in besonderem Maße auf eine gute medizinische Versorgung angewiesen ist. Denn neben körperlichen und/oder geistigen Einschränkungen leiden Menschen mit Behinderungen häufig an weiteren, zum Teil seltenen Begleiterkrankungen. Dennoch stößt gerade dieser Personenkreis im Gesundheitssystem immer wieder auf Hürden und Diskriminierungen – etwa, weil Praxen nicht barrierefrei sind, Betroffene nicht ernst genommen werden oder Ärztinnen schlicht die Zeit oder das Fachwissen für eine bedarfsgerechte Behandlung fehlt. „Menschen mit kognitiver oder körperlicher Mehrfachbehinderung sind häufiger krank und in der Gesundheitsversorgung benachteiligt“, fasst Dr. med. Tanja Sappok zusammen. Als bundesweit erste Professorin für „Medizin für Menschen mit Behinderungen, Schwerpunkt psychische Gesundheit“ will sie gemeinsam mit Kolleginnen dazu beitragen, diese Situation zu verbessern. An der Medizinischen Fakultät OWL beschäftigen sich insgesamt gleich vier Professor*innen und Arbeitsgruppen in Forschung und Lehre mit dem Thema – ein in Deutschland einmaliger und innovativer Ansatz, sagt Dekanin Prof. Dr. med. Claudia Homberg.

© Mario Haase/EvKB
Die Umweltmedizinerin hat das Forschungsprofil maßgeblich mitentwickelt und knüpft damit an ihre Arbeiten an der Fakultät Gesundheitswissenschaften an. Seit mehr als zehn Jahren forscht Claudia Homberg zur Gesundheitsversorgung von Menschen mit Behinderungen und stellt in vielen Bereichen eine medizinische Unter- oder Fehlversorgung fest. So habe sich gezeigt, dass Menschen mit Behinderungen weniger Vorsorgeangebote nutzen, Frauen seltener zur Krebsvorsorge gehen – zum Beispiel, weil zu wenige gynäkologische Praxen barrierefrei sind. Die Komplexität mancher Behinderungsformen führe zudem dazu, dass nicht alle Beschwerden adäquat behandelt würden. „Trisomie 21 zum Beispiel geht häufig mit mehreren begleitenden Krankheitsbildern einher.“
Vielfältige Gründe für Benachteiligungen
Zeitmangel und die enge Taktung in der ambulanten Routineversorgung seien weitere Faktoren, die zu Benachteiligungen für Menschen mit Behinderungen führten, ergänzt Versorgungsforscherin Prof. Dr. med. Sabine Steinke.

© Universität Bielefeld
Die Behandlung von Menschen mit Einschränkungen ist komplex und die dafür notwendige Zeit werde im aktuell bestehenden Versorgungssystem nicht ermöglicht oder entsprechend vergütet, sagt sie. Auch müssten Betroffene oft verschiedene Fachärzt*innen aufsuchen, was mit einem hohen organisatorischen Aufwand verbunden ist. Was kann Menschen mit Behinderungen helfen? Welche Bedürfnisse haben sie und ihre Angehörigen an die medizinische Versorgung? Wie müsste diese zukünftig gestaltet werden, um bedarfsgerecht auf Menschen mit chronischen Erkrankungen und Behinderungen eingehen zu können? Diesen Themen widmet sich Sabine Steinke im Rahmen ihrer Stiftungsprofessur, die von der C.D.-Stiftung über den Stifterverband gefördert wird. Gleichzeitig ist die Dermatologin als niedergelassene Ärztin selbst nah dran an der ambulanten Versorgung und schlägt so eine Brücke zur universitären Wissenschaft und Lehre. Zeigen möchte sie zudem, wie breit das Spektrum der Behinderungen ist. „Auch viele Hauterkrankungen sind chronisch und gehen zum Teil mit schweren Behinderungen einher“. Genetisch bedingte Hauterkrankungen wie Ichthyosen, aber auch häufigere Erkrankungen wie schwere Schuppenflechte, Neurodermitis und Urtikaria sind nur einige Beispiele. „Die Patient*innen und ihre Familien sind im Alltag und Sozialleben oft stark beeinträchtigt, sie fühlen sich stigmatisiert und können viele Berufe nicht ausüben.“
Inklusive Medizin als Querschnittsaufgabe
Im Studium werden solche und andere Aspekte der Behindertenmedizin in allen Modulen aufgegriffen und sollen sich durch das gesamte Curriculum ziehen. An der Universitätsklinik für Inklusive Medizin am Krankenhaus Mara können Studierende außerdem praktische Erfahrungen sammeln und haben frühzeitig Kontakt zu Patient*innen. Und auch die Forschungsvorhaben sind breit gefächert, reichen von der Analyse der Versorgungssituation bis hin zu einer systematischen Untersuchung bestimmter Krankheitsbilder und Problemstellungen, um Grundlagen für eine bessere, evidenzbasierte Behandlung zu schaffen, erläutert Tanja Sappok, Direktorin der Universitätsklinik für Inklusive Medizin. Fragestellungen gibt es viele: Wie lässt sich eine Demenz bei Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung zuverlässig diagnostizieren? Gibt es Zusammenhänge zwischen Krebserkrankungen und bestimmten Behinderungsformen? Inwieweit sind Menschen mit Mehrfachbehinderungen zusätzlich von Hauterkrankungen betroffen, werden aber nicht entsprechend versorgt, weil sie Symptome nicht benennen können?
Soft Skills und Kommunikation
Alle Beteiligten betonen, dass neben Fachwissen sogenannte Soft Skills und kommunikative Fähigkeiten für eine gute inklusive Medizin wichtig sind – das spiegelt sich auch im Studium wider. Wie führen Ärzt*innen ein Gespräch mit Menschen, die sich nicht gut ausdrücken können? Wie gehen sie mit Verhaltensauffälligkeiten um? Wie stellen sie sicher, dass Menschen mit kognitiven Einschränkungen selbstbestimmt entscheiden und ihre Wünsche in die Behandlung einfließen? Tanja Sappok möchte den Studierenden hier Handwerkszeug für den Berufsalltag mitgeben, angefangen bei Leichter Sprache bis hin zu nonverbalen Verständigungsmöglichkeiten. „Man kann Piktogramme nutzen, Anschauungsmaterial bereithalten, Behandlungsschritte an einer Puppe demonstrieren“, erklärt die Neurologin und Psychiaterin. „Oft ziehe ich auch einfach meinen weißen Kittel aus, weil der so angstbesetzt ist und ich zunächst Vertrauen aufbauen muss.“

© Universität Bielefeld/Sarah Jonek
Nicht zuletzt sind neben den Betroffenen meist eine ganze Reihe weiterer Akteure mit im Boot: Familienangehörige, gesetzliche Betreuerinnen, Pflegekräfte. Auch das mache die Kommunikation anspruchsvoll, ergänzt Dr. med. Christian Brandt, leitender Abteilungsarzt am Epilepsiezentrum Bethel. Mit seiner Professur für Epileptologie deckt er einen wichtigen Bereich in der Behindertenmedizin ab. „Epilepsie ist eine der häufigsten Begleiterkrankungen bei Menschen mit geistiger Behinderung. Rund 25 Prozent sind davon betroffen.“ Betrachtet man alle Menschen mit Epilepsie, haben davon wiederum 25 Prozent eine geistige Behinderung. „Es gibt eine große Schnittmenge“, sagt der Neurologe, und die Behandlung erfordere ein hohes Maß an Professionalität. Medikamente werden zum Beispiel von Menschen mit Epilepsie und einer geistigen Behinderung anders vertragen als von Menschen ohne Behinderung. „Darüber sollten angehende Ärztinnen aller Fachrichtungen Bescheid wissen“, meint Brandt, auch wenn die meisten Studierenden später nicht explizit in der Behindertenmedizin arbeiten werden. Aber überall, in Kliniken und Praxen, von der Augenheilkunde bis zur Orthopädie, werden sie mit Menschen mit Beeinträchtigungen zu tun haben und sollten entsprechend geschult sein.
Erfahrungen aus erster Hand

© Copyright: Peter Himsel www.himsel.de
Erfahrungen aus erster Hand
Um mehr Verständnis für die Sicht der Betroffenen zu bekommen, werden in Mara demnächst Menschen mit Epilepsie in Lehrveranstaltungen mitwirken, berichtet Brandt weiter. Als „Expert*innen in eigener Sache“ sollen sie Studierenden schildern, wie sie den Umgang mit Ärzt*innen und Gesundheitspersonal erleben. Auch in einem aktuellen Forschungsprojekt von Claudia Hornberg kommen Betroffene zu Wort. In dem Projekt „OptiKomm“, gefördert von der Dr. Helene-Charlotte-Wolf-Stiftung im Stifterverband, werden Patient*innen mit kognitiven und/oder sprachlichen Beeinträchtigungen zu ihren Erfahrungen in der Kommunikation mit medizinischem Personal interviewt. Zudem werden die Bedarfe, Bedürfnisse und Herausforderungen aus Sicht von Ärzt*innen erhoben. Ziel sei es, ein Schulungskonzept für medizinisches Personal zu entwickeln, um die Kommunikation zu verbessern, so Hornberg, denn: „In der medizinischen Versorgung kommt es häufig vor, dass medizinische Fachkräfte die Fähigkeiten, Bedürfnisse oder Lebensqualität von Menschen mit Behinderungen aus ihrer Sicht beurteilen und bestimmte Annahmen treffen, ohne angemessen zu berücksichtigen, was die betroffene Person selbst äußert.“ Gerade auch Erkenntnisse aus dem Projekt „OptiKomm“ hätten gezeigt, dass Menschen mit Behinderungen häufig diskriminiert werden, „da das medizinische Personal den Personen wenig zutraut und sie daher auch nicht in Entscheidungsprozesse einbezieht.“