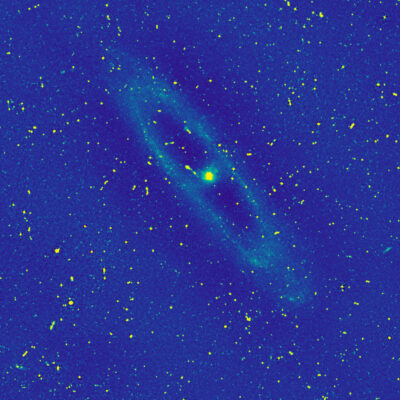Dreißig Jahre nach der Entdeckung mütterlicher Hormone in Vogeleiern bleiben ihre evolutionären Folgen ungeklärt. In einer kürzlich in der Fachzeitschrift Ecology Letters veröffentlichten groß angelegten, vorregistrierten Meta-Analyse versuchte ein internationales Forschungsteam, Licht in dieses komplexe Forschungsfeld zu bringen. Der Letztautor der Studie, Dr. Alfredo Sánchez-Tójar von der Fakultät für Biologie der Universität Bielefeld und assoziiertes Mitglied des Sonderforschungsbereichs TRR 212 („NC³“), analysierte zusammen mit seinen Co-Autoren systematisch 438 Effektstärken aus 57 Studien zu 19 wildlebenden Vogelarten. Ziel war es, zu untersuchen, ob höhere Konzentrationen mütterlicher Hormone in Eiern tatsächlich mit Fitnessvorteilen für Nachkommen und Eltern verbunden sind.
Die Ergebnisse der Studie liefern eine unerwartete Erkenntnis: Entgegen der weit verbreiteten Annahme, dass mütterliche Hormone gezielt zur Optimierung des Fortpflanzungserfolgs eingesetzt werden, zeigte die Meta-Analyse nur einen sehr schwachen und stark variablen Einfluss auf Fitness-Maßzahlen. Überraschenderweise konnten weder die Art des Hormons, das Alter der untersuchten Vögel noch methodische Unterschiede zwischen den Studien diese Variabilität ausreichend erklären. Stattdessen scheint die Heterogenität der Ergebnisse durch die phylogenetische Geschichte, also die evolutionäre Entwicklung und Verwandtschaftsverhältnisse von Organismen über lange Zeiträume hinweg, und Unterschiede innerhalb einzelner Studien beeinflusst zu werden.
Diese umfassende Synthese stellt viele bestehende Hypothesen über mütterliche Effekte infrage und hebt gleichzeitig zentrale offene Forschungsfragen hervor. Im Interview werden die wichtigsten Ergebnisse der Studie erläutert, methodische Herausforderungen beschrieben und vielversprechende zukünftige Forschungsrichtungen vorgestellt. Drei Fragen an Dr. Alfredo Sánchez-Tójar.
Interview: „Zukünftige Forschung sollte einen ganzheitlicheren Ansatz verfolgen.“
Ihre Meta-Analyse zeigt, dass der durchschnittliche Effekt von Eihormonen auf die Fitness in wilden Vogelpopulationen überraschend gering ist. Was bedeuten diese Ergebnisse für unser derzeitiges Verständnis mütterlicher Effekte – und was bedeutet das für künftige Forschung in diesem Bereich?
Unsere Ergebnisse stellen die weit verbreitete Ansicht infrage, dass Eihormone eine durchgängig starke und richtungsweisende Rolle bei adaptiven mütterlichen Effekten spielen. Zukünftige Forschung sollte sich darauf konzentrieren, mögliche Kontextabhängigkeiten zu verstehen, alternative Mechanismen mütterlicher Effekte zu erforschen und Methoden zu verfeinern, um unser Verständnis dieses komplexen Feldes zu verbessern. Zudem sollte aufgrund der besonders niedrigen Berichtsqualität in diesem Forschungsbereich – die uns daran hinderte, zusätzliche 25 Prozent der Studien einzubeziehen – verstärkt auf Open-Science-Praktiken wie Datenaustausch und die Vermeidung selektiver Berichterstattung gesetzt werden.
Sie haben eine hohe Variabilität der Effekte festgestellt, die nicht durch offensichtliche Faktoren wie Hormonart oder Alter erklärt werden konnte. Welche biologischen oder ökologischen Mechanismen könnten dennoch zu dieser Heterogenität beitragen?
Die ungeklärte Heterogenität resultiert vermutlich aus dem komplexen Zusammenspiel von Umweltbedingungen und der Wechselwirkung mehrerer mütterlicher Einflüsse auf das Ei. Auch die aktiven Rolle des sich entwickelnden Embryos bei der Verarbeitung dieser Einflüsse sowie grundlegenden Unterschieden in der Lebensgeschichte und Physiologie verschiedener Arten sind von Relevanz. Da ein Großteil der beobachteten Variabilität auf Studienebene auftrat, könnte zudem eine ungenaue Methodik ein entscheidender Faktor für die hohe Variation sein. Zukünftige Forschung sollte einen ganzheitlicheren Ansatz verfolgen, um diese interagierenden Faktoren zu entwirren und die kontextabhängige Natur der Eihormon-Effekte auf die Fitness besser zu verstehen.
Ihre Studie hebt viele offene Fragen hervor, darunter die Rolle von Umwelteinflüssen und geschlechtsspezifischen Effekten. Welche Forschungsansätze halten Sie für besonders vielversprechend, um diese Lücken in Zukunft zu schließen?
Erstens könnte die Untersuchung einer größeren Anzahl phylogenetisch unterschiedlicher Arten sowie die Berücksichtigung des Umweltkontextes, den sowohl Mütter als auch Nachkommen erfahren, dazu beitragen, unterschiedliche Muster zu erkennen und Kontextabhängigkeiten zu erklären.
Zweitens ist es entscheidend, die Mechanismen zu klären, die die Hormonablagerung in Eiern regulieren, und das Ausmaß zu bestimmen, in dem dieser Prozess kontrolliert ist. Da Embryonen keine passiven Empfänger mütterlicher Hormone sind, sondern sie auch metabolisieren können, ist es außerdem wichtig, den embryonalen Hormonstoffwechsel zu untersuchen, um die zugrunde liegenden Mechanismen besser zu verstehen und fundiertere Hypothesen zu formulieren.
Schließlich deutet unsere Studie darauf hin, dass es innerhalb einzelner Studien eine hohe Variabilität gibt, was davon zeugt, dass ungenaue Methoden – beispielsweise zur Extraktion von Hormonen – einen erheblichen Teil der Variation erklären könnten. Es sollten daher verstärkt Anstrengungen unternommen werden, um Methoden zu standardisieren und zu validieren.

© privat