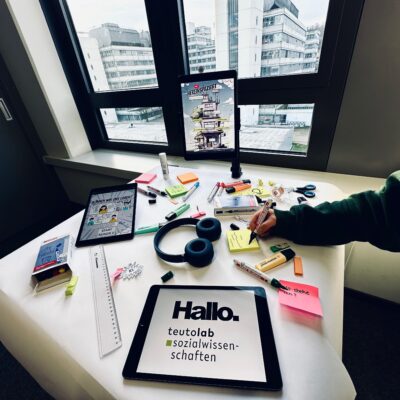Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) fördert die Forschung von Dr. Verónica Dodero an der Universität Bielefeld ab März für drei Jahre mit 660.000 Euro. Sie untersucht chemische Aspekte von Glutenmolekülen, die deren Wirkung im Körper bestimmen und das Verständnis glutenbedingter Erkrankungen vertiefen. Die Ergebnisse könnten neue Ansätze für Prävention und Therapie ermöglichen.
Fast jeder Mensch nimmt täglich Gluten zu sich – sei es durch Weizen, Dinkel, Gerste oder Roggen. Doch was passiert damit im Körper? „Die wenigsten wissen, dass Gluten nicht vollständig verdaut wird“, sagt die Chemikerin Dr. Verónica Dodero von der Universität Bielefeld. Für die meisten Menschen scheint das nicht weiter problematisch zu sein. Doch etwa fünf Prozent der Menschen weltweit leiden unter glutenbezogenen Störungen wie Zöliakie oder Weizenunverträglichkeit.
Zöliakie ist eine Autoimmunerkrankung, bei der Gluten eine Entzündung im Darm auslöst und die Schleimhaut schädigt. Doch auch Menschen, die nicht unter einer Zöliakie leiden, können empfindlich auf Gluten reagieren. „Es ist bereits bekannt, dass Glutenproteine eine zentrale Rolle spielen, da die Erkrankungen unter einer glutenfreien Ernährung abklingen“, sagt Dodero. Dabei entstehen bestimmte Glutenpeptide (PRGP), die nicht weiter abgebaut werden. Sie gelangen vom Darm ins Blut und können dort Immunreaktionen triggern.

© Patrick Pollmeier
Noch viele Fragen offen
Trotz der vielen Fortschritte in der Zöliakie und anderer glutenbezogener Störungen gibt es noch viele offene Fragen. „Unsere Forschung, die vor zehn Jahren in Bielefeld begann, zielt darauf ab, die Rolle der Gluten-PRGP in den frühen Stadien der Krankheit zu verstehen“, sagt Dodero. Dies setzt an, noch bevor das betroffene Immunsystem Glutenfragmente als gefährlich einstuft und die Immunreaktion auslöst.
Im Fokus dabei steht auch die Darmschleimhaut: Sie ist eine Schutzbarriere des Körpers gegen Schadstoffe. Wenn sie geschwächt wird, kann es zum sogenannten Leaky-Gut-Syndrom kommen. Dabei wird die Darmwand durchlässiger, sodass unverdaute Bestandteile aus der Nahrung, Bakterien und Viren aus dem Darm in den Körper gelangen können, und eine massive Entzündungsreaktion auslösen.
Bislang gingen Forschende davon aus, dass chronische Entzündungen bei Zöliakie die Darmwand durchlässiger machen. Doch eine andere Theorie besagt, dass die Gluten-Peptide direkt die Darmschleimhaut schädigen und damit erst die Autoimmunreaktion auslösen könnten. „Die geschwächte Darmbarriere könnte nicht nur eine Folge, sondern eine Ursache von Zöliakie sein“, sagt Verónica Dodero.
Mechanismen auf zellulärer Ebene
Sie konnte bereits zeigen, dass sich die unvollständig verdauten Gluten-Moleküle Nanostrukturen bilden und im Darmmodell schädigend wirken. „Wir haben im Zellmodell gesehen, dass sie sich ansammeln und einen sogenannten Leaky Gut auslösen können“, sagt die Chemikerin. Unter dem Mikroskop konnte sie nachweisen, dass sich diese Strukturen in Darmzellen ansammeln.
Im Zentrum der Forschung von Verónica Dodero steht das 33-mer-Gliadin-Peptid. Es entsteht durch unvollständig abgebautes Weizengluten, das bei Menschen mit Zöliakie eine Immunreaktion auslöst. „Wir wissen, dass das 33-mer-Peptid Nanostrukturen bildet und das Immunzellen aktivieren kann – aber welche molekularen Mechanismen genau dahinterstecken, ist noch unklar“, sagt Dodero.
Frühere Untersuchungen zeigten, dass diese Nanostrukturen eine parallele β-Struktur annehmen – ein Muster, das auch bei neurologischen Erkrankungen wie Alzheimer oder Parkinson eine Rolle spielt. „Wir vermuten, dass die Ansammlung dieser Moleküle ein Auslöser glutenbedingter Erkrankungen sein könnte, der bislang übersehen worden ist“, sagt die Forscherin.
Since gluten is not fully digested, large gluten fragments enter into our body triggering Gluten Related Disorders in predisposed people.
Large fragments are transported from the stomach to the gut and from there to the bloodstream.
In Celiac patients, for example, gluten triggers a severe autoimmune reaction that isn’t necessarily evident in other patients.
So what are the gluten features that drive disease in five percent of the global population?
Much is already well known, but recently a new feature was discovered at Veronica Dodero’s lab. They found that wheat fragments form superstructures known as protein aggregates.
In cell models, Gluten Aggregates accumulate triggering inflammation and apoptotic molecules.
Dr Dodero’s hypothesis is that wheat superstructures play a role in the initial stages of Gluten Related Disorders and she hopes to soon discover more about the role of such Aggregates in health and disease.
Interdisziplinäre Forschung für neue Erkenntnisse
Um diese offenen Fragen zu klären, kombiniert Dodero verschiedene Methoden und arbeitet dabei interdisziplinär eng mit anderen Forschenden an der Universität Bielefeld zusammen. Die aus Argentinien und Spanien stammende Wissenschaftlerin hat ihre Forschung in den vergangenen zehn Jahren in Bielefeld aufgebaut.
Doderos aktuelle Forschung im DFG-Projekt zielt auch darauf ab, herauszufinden, die chemischen Aspekte der Peptid-Bruchstücke und ihrer Nanostrukturen zu verstehen, um deren Effekt auf die Ernährung und Krankheiten besser zu verstehen. So könnte es möglich sein, durch Ernährung glutenbedingten Entzündungsprozesse zu beeinflussen und somit das Risiko für diese Erkrankungen zu senken.