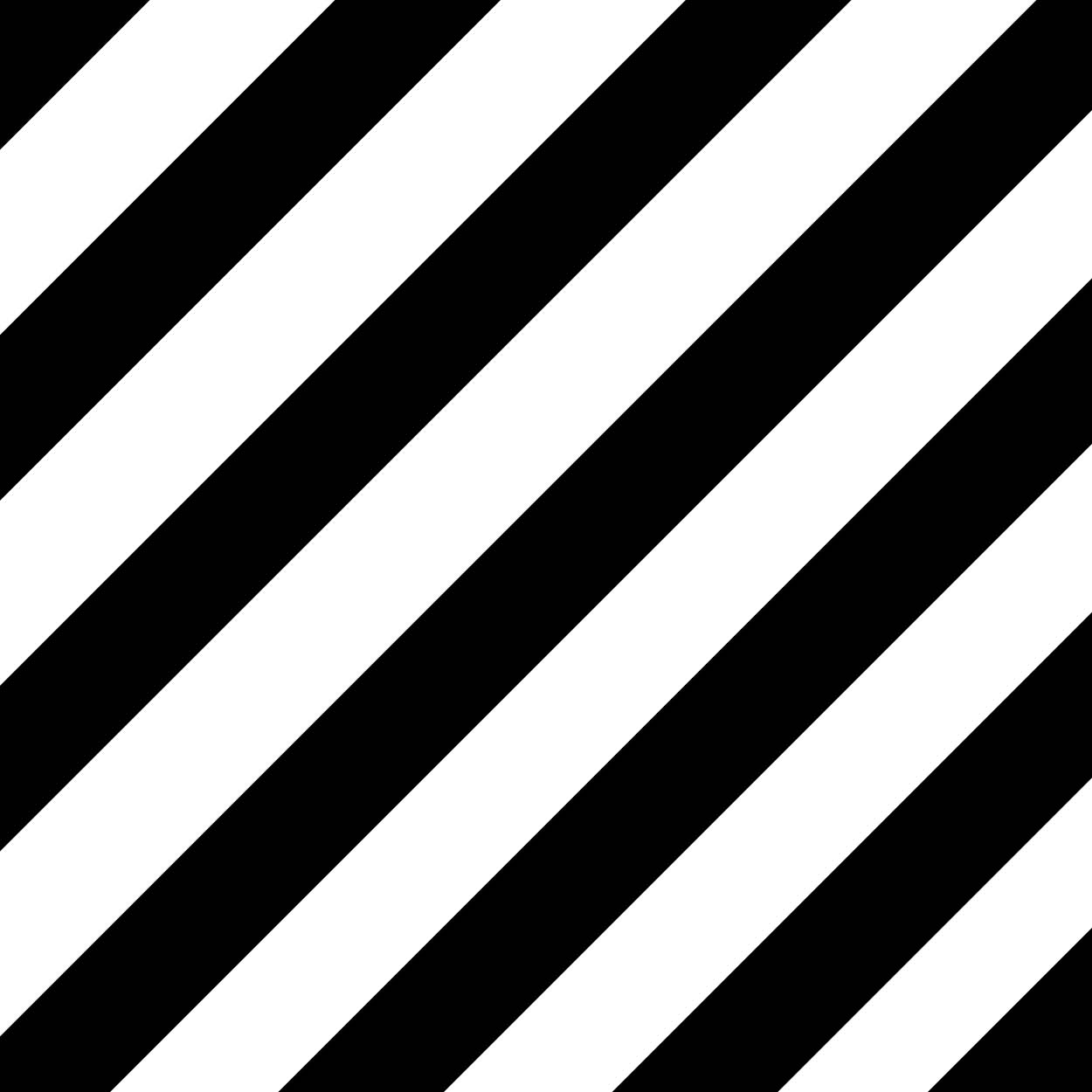Reallabore sind eine noch neue Art, Wissenschaft zu betreiben. Ihre Vorzüge überzeugen jedoch in dem Maße, dass die Bundesregierung dabei ist, ein Gesetz zu ihrer Förderung zu erarbeiten. Was Reallabore für Wissenschaftler*innen so interessant macht, wie darin geforscht wird und welche Art von Erkenntnissen sie generieren, damit befasst sich die Kooperationsgruppe „Experimentieren in offenen Systemen – zur Epistemologie von Reallaboren“, die derzeit am ZiF arbeitet. Der nächste Workshop der Gruppe findet am 21. und 22. Oktober statt. Der Soziologe und Technikphilosoph Professor i.R. Dr. Wolfgang Krohn (Bielefeld) gibt im Interview Einblick in die Forschung der Gruppe, die er gemeinsam mit drei Kolleg*innen leitet: dem Nachhaltigkeitsforscher Professor Dr. Matthias Bergmann (Frankfurt a.M.), dem Wissenschafts- und Technikforscher Professor Dr. Stefan Böschen (Aachen) und der Philosophin Professorin Dr. Gabriele Gramelsberger (Aachen).
Was ist eigentlich unter dem Begriff Reallabor zu verstehen?
Wolfgang Krohn: Ein Reallabor lässt sich gut durch den Gegenbegriff beschreiben – das wissenschaftliche Labor. In einem wissenschaftlichen Labor werden Experimente unter isolierten Bedingungen durchgeführt. Die Wissenschaftler*innen möchten genau wissen, was sie messen, und schirmen die Experimente dazu von störenden Einflüssen ab. In Reallaboren gibt es diese Abgrenzung zur wirklichen Welt nicht, daher kommt der Name. Es sind Labore in der realen Welt, dort findet die Forschung statt. Ein zweiter Unterschied ist, dass Reallabore fast immer mit Beteiligung von nicht-wissenschaftlichen Personen stattfinden, also Menschen aus der Bevölkerung, aus Interessengruppen – sie arbeiten zusammen mit den Forscher*innen. Das wiederum bedeutet, dass nicht mehr klar zwischen Wissenschaft und Anwendungspraxis unterschieden werden kann. Die klassische Ansicht ist, dass die Wissenschaft Ergebnisse erzeugt, die dann anderswo verwendet werden können. In einem Reallabor ist die Praxis Teil des Forschungsprozesses. Das heißt auch, dass alle Beteiligten ein Risiko eingehen: sie lassen sich auf einen offenen Forschungsprozess ein, bei dem unklar ist, wohin er führt. Wir sind es gewohnt, dass die Politik Pläne vorgibt, die dann ausgeführt werden. In den Innovationsprozessen, wie sie durch Reallabore, beispielsweise bei einer Stadtteilentwicklung, in Gang gesetzt werden, verläuft nicht immer alles geradlinig. Experimentelle Forschung birgt immer das Risiko des Scheiterns. Das ist auch eine Zumutung für die Gruppen, die daran beteiligt sind.

© Universität Bielefeld
Was macht ein gutes Reallabor aus?
Wolfgang Krohn: Wichtig ist es, die Teilnehmenden schon bei der Entwicklung eines Experimentaldesigns mit einzubinden. Die Beteiligten erst im Nachhinein einzubeziehen wäre nicht zielführend. Es muss für alle klar sein, dass nicht feststeht, wie sich ein Projekt entwickeln wird. Die Reallabore haben eine rekursive Dynamik, das heißt, man muss bemerken, wenn etwas aus dem Ruder läuft oder sich eine zusätzliche Chance bietet und auch während des Forschungsprozesses am Experimentaldesign weiterarbeiten. So werden Fehlschläge und Enttäuschungen verhindert. Die Erfahrung zeigt, dass es den Beteiligten überwiegend großen Spaß macht und sie viel Engagement aufbringen, um mitzumachen.
Ihre Gruppe am ZiF befasst sich mit der Epistemologie, also der Erkenntnistheorie, von Reallaboren. Was ist epistemologisch daran spannend?
Wolfgang Krohn: Uns interessiert, welche Art von wissenschaftlicher Erkenntnis in Reallaboren erzeugt wird. In der Standardwissenschaft gibt es experimentelle Erfolge –um eine belastbare wissenschaftliche Aussage daraus zu generieren, müssen diese aber wiederholbar sein und verschriftlicht werden. In einem Reallabor ist das so zunächst nicht möglich. Das macht die Frage nach der Wissensqualität, also welche Art von Wissen hier überhaupt erzeugt wird, so spannend. Bei einem Reallabor geht es in erster Linie um den erfolgreichen Abschluss des Vorhabens. Als Beispiel könnte eine Stadtteilentwicklung betrachtet werden. Funktioniert diese Entwicklung gut, war das Vorhaben erfolgreich. Anschließend müsste untersucht werden, welches Wissen mit diesem Erfolg verbunden ist. Könnten die gewonnenen Erkenntnisse verallgemeinert und unter ähnlichen Bedingungen wiederverwendet werden? Bei einer Stadtteilentwicklung erscheint das nicht realistisch. Der größte Unterschied zur traditionellen Wissenschaft besteht daher zu den Standards der Übertragbarkeit, Verallgemeinerungsfähigkeit und Situationsunabhängigkeit dessen, was herausgefunden wurde. Vieles an den Realexperimenten ist wegen der Komplexität unserer Realität kontingent, also mit Zufallsfaktoren durchsetzt. Als Wissenschaftsforscher*innen analysieren wir aber nicht nur, wir möchten auch zur Qualitätskontrolle beitragen und aufzeigen, was ein gutes Reallabor ausmacht.