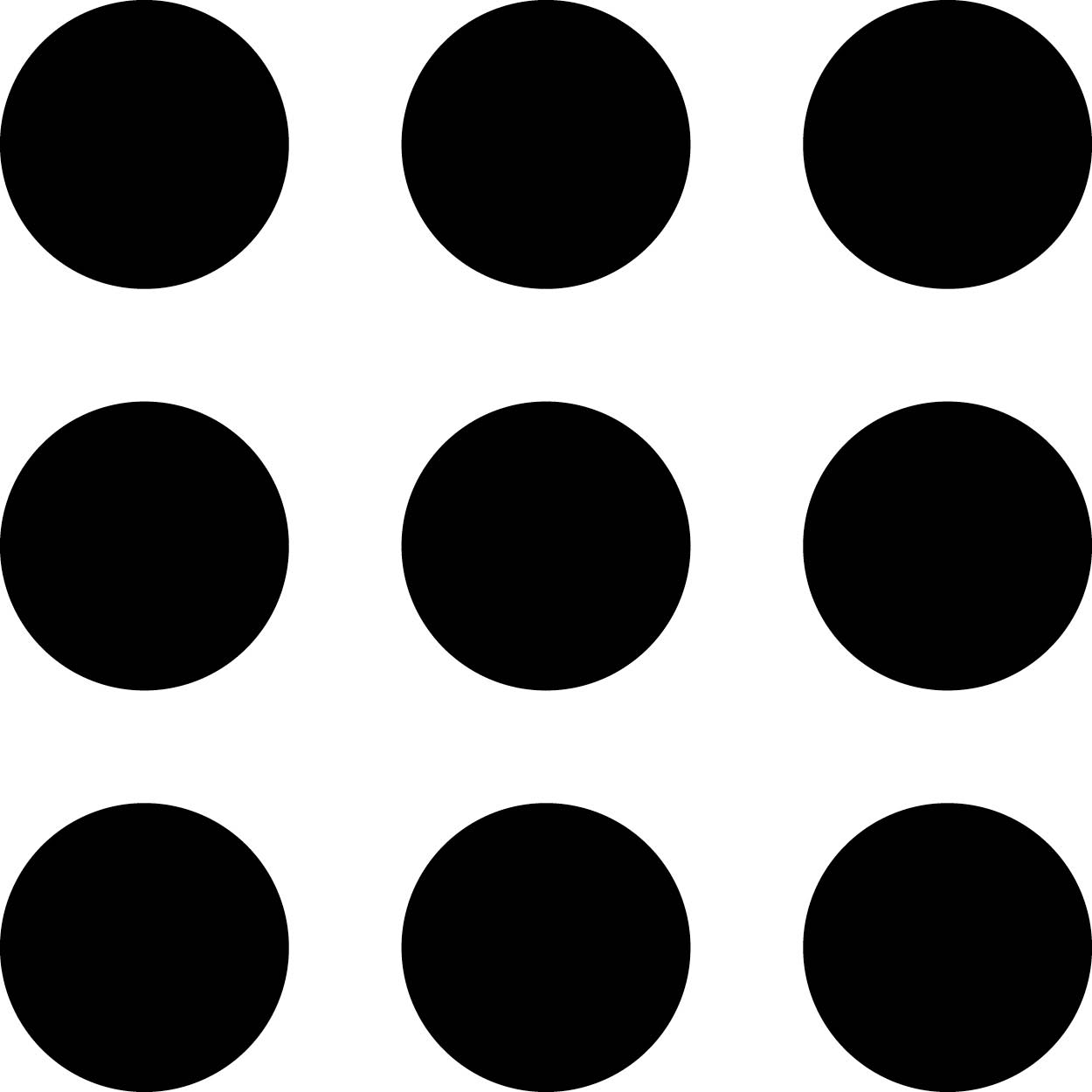Ich rede über Entscheidungen unter Unsicherheitsbedingungen. Ich meine, wenn man so einen Untertitel hat, ist es klar, dass ich den Pleonasmus meine. Es gibt keine Entscheidungen ohne Unsicherheit. Nur hilft das natürlich nicht weiter. Das wäre ein Glasperlenspiel, wenn man es dabei belassen würde. Und der Vortrag wäre allzu kurz. Insofern mache ich da eine durchaus längere Version davon, um zu beschreiben, dass es wirklich ein Pleonasmus ist. Aber was ich auch anbieten möchte, das ist eine bestimmte theoretische Perspektive, von der ich durchaus meine, dass sie empirische Konsequenzen hat, wenn man sie ernst nimmt. Und ich habe… Ich fange an mit ein paar Sätzen, die gar nicht so entscheidend sind. Und ich zähle mit Null, damit am Ende das bis fünf geht, weil nach der klassischen Rhetorik müssen es fünf oder sieben sein. Wenn es sechs wären, wäre das Argument falsch. Und insofern muss ich mich da selber ein bisschen austricksen. Es ist relativ einfach zu sagen, dass wir in einer Entscheidungsgesellschaft leben, dass immer diese Begriffe so Komposita mit Gesellschaft stimmen ja fast nie. Aber man kann zumindest sagen, dass ein Grundzug moderner Gesellschaften ist, dass sich fast nichts von selbst fügt und über fast alles entschieden werden muss. Und dieser Satz ist unglaublich leicht zu verstehen und dem kann man auch ganz leicht zustimmen. Das Problem ist nur, er stimmt womöglich gar nicht. Genauer wäre, dass wir so tun, als sei alles, was geschieht, das Ergebnis von Entscheidungen. Also wenn wir Sachverhalte sehen, die einen Informationswert besitzen… Das ist das Problem bei Sachverhalten, dass wir ja nie Sachverhalte sehen, sondern dass es ein Informationswert haben muss, damit etwas, das gesagt werden kann, ein Sachverhalt ist. Dann ist es eigentlich nicht schlecht zu sagen, der hätte erstens anders sein können und weil er hätte anders sein können, muss es offenbar ein Punkt geben, an dem entschieden wird, dass er so und nicht anders ist, und das nennen wir gerne eine Entscheidung. Und zwar gilt das für das persönliche Leben, das gilt für ökonomische Entscheidungen, für politische Entscheidungen, für wissenschaftliche Entscheidungen. Das gilt eigentlich für fast alles. Und wenn wir Leute dazu bringen, ihr Alltagsverhalten, über das sie nicht explizit entscheiden, zu begründen, dann begründen sie das als Entscheidungsgeschichte. Ich habe das mal mit Studierenden ausprobiert, Die sollten auf die Straße gehen. Das war so ein Kurs für qualitative Sozialforschung. Die sollten auf der Straße die Leute fragen, warum sie, wenn sie mit dem Fahrrad oder dem Automobil fahren, immer rechts aneinander vorbeifahren. Das machen wir ja normalerweise. Wenn wir es nicht machen, kommen wir meistens nicht lebend an, also meistens kommt man dann einmal nicht lebend an. Und wir tun das von selbst. Man entscheidet sich nicht dafür. Aber wenn die Leute begründen, warum sie das machen, fallen ihnen Entscheidungsgründe ein. Also man sagt, es ist eigentlich eine tolle Sache, wenn beide rechts fahren bzw. rechts ausweichen, weil man dann die Kollisionsgefahr senkt. Deshalb entscheide ich mich immer genau das zu machen. Was natürlich Unsinn ist, das macht fast niemand als Entscheidung. Es sei denn, es hat einen Informationswert. Sie waren wahrscheinlich alle schon mal in London. Der große Unterschied der Innenstadt von London und der Außenbezirke ist, dass man in der Innenstadt darauf hingewiesen wird, in welche Richtung man gucken muss, draußen nicht mehr. Da muss man sich entscheiden, wo muss ich jetzt nochmal hingucken, weil es einen Informationswert hat. So, das zweite Problem mit den Entscheidungen ist, dass das Ding nicht will. [Probleme mit der Fernbedienung]. Wo ist der … Geht nicht. Was muss ich machen? Ah, jetzt. Bitte? Hat eine lange Leitung, ja. Also, noch interessanter ist, dass es selten eine eindeutige Kausalität zwischen Entscheidungen und der in der Entscheidung antizipierten Wirkung gibt. Auch das kennen wir, wie kontingent die Zurechnung von Entscheidungen üblicherweise sind. Also, ich bringe jetzt mal wirklich so banale Beispiele. Das banalste Beispiel ist der Unterschied, wie Regierung und Opposition auf politische Wirkungen gucken. Wenn’s gut läuft, rechnet sich die Regierung zu, das liegt natürlich daran, dass wir die Steuern gesenkt haben. Wenn’s schlecht läuft, liegt es auch daran, dass wir die Steuern gesenkt haben, aber das sagen dann die anderen. Und es hört sich an wie ein banales Beispiel, das ist aber alles andere als banal, weil wir aus keiner der beiden Perspektiven wirklich genau sagen können, wo die Kausalität liegt. In der empirischen Sozialforschung hat man das Problem, dass man, wenn man Kausalitäten beschreiben will, durchaus vorher Entscheidungen darüber treffen muss, welche Parameter man verwendet, um einen Zusammenhang für eine Kausalität zu halten. Und das sind meistens keine, die den Bedingungen der Kausalität, wenn man sie streng formuliert, entsprechen. Und das gilt nicht nur für die empirische Sozialforschung, sondern das gilt auch für unser Alltagsleben. Der gepflegte Ehestreit ist ein Streit um Kausalitäten. Du hast doch angefangen! Kennen Sie, ne? Ich kenne es. Trotzdem rechnen wir Wirkungen in der Gegenwart ursächlichen Entscheidungen in der Vergangenheit zu oder erwarten von gegenwärtigen Entscheidungen entsprechende Zukunftswirkungen. Also, wenn die Soziologinnen und Soziologen obercool irgendwo hingehen und die Entscheidungen dekonstruieren, hat das ja nicht zur Folge zu sagen, dann lassen wir das mit dem Entscheiden eben. Man kann nicht zufällig hier oder dort investieren, man kann nicht zufällig diesen oder jenen wählen. Man kann nicht zufällig… Und so weiter. Und selbst wenn man es zufällig machen würde, die Geschichte kennt durchaus Formen, in denen man dem Zufall eine symbolische Form gibt, dann würde man sagen: Der Heilige Geist hat entschieden. Das Konklave ist zum Beispiel so etwas, bei dem man sagt, dass der Heilige Geist tatsächlich den Griffel der Kardinäle geführt hat. Und die Ergebnisse zeigen ja auch, dass das stimmt. Finden Sie nicht? Ich finde schon. Deshalb kann man sagen, dass Entscheidungen Konstruktionen von Ursachen und Wirkungen sind. Also, das heißt nicht, dass es keine Entscheidungen gibt. Das wäre totaler Quatsch. Aber es sind natürlich, wie soll man sagen, sehr selektive Beobachtungen von etwas, das aussieht wie eine kausale Beziehung. Selektiv deshalb, weil, wenn man genau hinguckt… Das ist übrigens eines der Probleme wissenschaftlicher Beobachtung, man immer mehr Faktoren sieht und es immer unsicherer wird, an welchem der Einzelfaktoren denn eigentlich der Punkt ist, an dem es entschieden worden ist. Und man kann, wenn man das interdisziplinär sich anguckt, vielleicht viel von den Textwissenschaften, von den Literaturwissenschaften zum Beispiel, lernen. Nur wenn man sich fragt, wie beschreibt man eigentlich literarisch etwas, was geschieht? Dann ist ja das Tolle am auktorialen Erzähler, dass er in der Lage ist, die unterschiedlichen Kausalpunkte um die es geht, so zu konstruieren, dass es am Ende aufgeht. Dummerweise ist es nur so, dass wir das gewissermaßen im richtigen Leben auch machen. Und dann entdecken wir Entscheidungsgeschichten über das gleiche Geschehen, die sich in unterschiedlichen Situationen voneinander unterscheiden. Der Klassiker ist hier natürlich das Ende einer Liebesbeziehung, in dem alles, was geschiet, anders beschrieben wird, als es vorher beschrieben worden ist. Kennen Sie auch, würde ich jetzt mal wetten. So. Das ist alles noch kein Argument, sondern nur eine Beschreibung. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass das nächste [ein] Argument ist, aber ich versuch’s zumindest. Falls die Seite hier weitergeht. Sie geht. Also, was gucken wir uns an, wenn wir uns empirische Entscheidungen angucken? Empirisch betrachtet sind Entscheidungen Zeitschnitte, die in der Gegenwart eine unbekannte oder unsichere Zukunft binden wollen. Also, einfach auf eine Formel gebracht: Wenn ich weiß, dass ich rechts abbiegen muss, muss ich mich nicht entscheiden. Wenn ich es nicht genau weiß, dann muss ich entscheiden. Und das ist außerordentlich wichtig, wenn man die Frage stellen will, ob wir eigentlich zurzeit in einer Situation leben, so sagt man ja gerne, in der das Entscheiden schwieriger geworden ist, weil die Kontingenzen größer sind, weil wir Krisen haben usw. Man vergisst interessanterweise, dass es in den Vergangenheiten auch schon viele Krisen gegeben hat und Handlungsgründe auch kontingent waren. Wenn sie nicht kontingent gewesen wären, würden wir gar nicht von Handlungen sprechen. Soziologisch sprechen wir von Handlungen dann, wenn ein Verhalten so ist, dass es auch anders hätte sein können. Und dann, die unterschiedlichen soziologischen Theorien würden dann sagen, dass es einen subjektiv gemeinten Sinn gibt oder nur Präferenzen oder schlicht und ergreifend nur ein Verhalten, das ein Beobachter bestimmten Präferenzen, die nicht unbedingt empirisch vorliegen müssen, zuordnet. Kennen wir alles. Das ist irgendwie Graubrot. Das Entscheidende ist die Unsicherheit. Ohne Unsicherheit – keine Entscheidung. Noch ein Beispiel aus der Lehre. In der gleichen Übung, also in solch einer Übung, von der ich gerade geredet habe, habe ich versucht, meinen Studierenden zu sagen, sie sollen sich vorstellen, sie wären mit einer Zeitmaschine. So was haben wir an der LMU aus Exzellenzmitteln. Ich muss es außerhalb Bayerns immer einmal erwähnen. Was hiermit geschehen ist, Entschuldigung, wir hätten eine Zeitmaschine und man könnte sozusagen mit einem Aufnahmegerät ins Mittelalter versetzt werden und jemanden fragen: Wann hast du dich entschieden, Bauer zu werden? Und die interessante Frage ist ja, dass man wahrscheinlich die Frage nicht verstehen würde, weil es nur wenige, also nicht keine natürlich, aber wenige Positionen gibt, in denen die Kontingenz so hoch ist, dass man symbolische Mittel braucht, um zu beschreiben, dass dies und nicht das geschieht. Also, es ist ganz entscheidend zu sagen wenige, wenn man behaupten würde gar keine, das wäre natürlich Unsinn, aber das ist nicht als grundlegendes gesellschaftliches Problem angesehen. Wenn wir heute uns angucken, entwicklungspsychologische Theorien an oder so etwas. Dann würde man sagen: Ab wann ist jemand eigentlich in der Lage, selbstständig eine Entscheidung zu treffen? Oder das, was er oder sie tut, zumindest auszuhalten als etwas, was man womöglich anders entschieden hätte, aber die Verhältnisse erlauben es nicht, oder sowas. Kennen wir auch alle aus dem eigenen Leben. Also, man muss Unsicherheit in die Sachen hineindenken, um von Entscheidungen zu reden. Nur die empirische Situation sieht ja meistens anders aus. Also Leute, die zum Entscheiden geboren sind, also Führungskräfte in Unternehmen, Präsidenten und Rektoren in Universitäten. Diese Leute, die halt entscheiden. Die gehen ja nicht hin und sagen, es ist sehr unsicher, was ich jetzt tun soll. Ich glaube, ich nehme dies und nicht das andere. Sondern man kann mit einer ganz bestimmten Form zeigen, dass man gute Gründe hat zu entscheiden. Wobei man die Gründe meistens nicht nennen muss. Und wenn man Gründe nennen muss, sind es Gründe, die weniger an der Sache der Entscheidung hängen, sondern daran, vor welchem Publikum welche Gründe wie funktionieren. Das ist das empirische Beobachten. Und das kann man tatsächlich rekonstruieren. Deshalb ist ja die interessante Frage, das sollte jetzt schnell gehen, ja, wer das eigentlich sieht, was ich gerade gesagt habe. Also, so ein Soziologe meines Typs würde dann immer sagen: Wir müssen den Beobachter auch mit ins Spiel bringen. Haben Sie schon erwartet? Wahrscheinlich. Aber es stimmt. Man muss ihn ins Spiel bringen, sonst sieht man ja nicht, wie man die Dinge sieht. Und das Interessante ist, dass man, wenn man den Beobachter ins Spiel bringt, man nicht mehr entscheiden muss, was eine Entscheidung ist, sondern welche Formen von Ereignissen eigentlich wie Entscheidungen aussehen. Weil Entscheidung natürlich, das ist sozusagen eine soziologische Selbstverständlichkeit, eine Zurechnungsfrage ist. Übrigens eine Zurechnungsfrage, die in der soziologischen Formierung des Gegenstandes auch vorkommt. Man würde zum Beispiel in der empirischen Sozialforschung, wenn man Leute befragt, das gilt für die qualitative wie für die quantitative Sozialforschung, immer sich Gedanken darüber machen müssen, wenn jemand unterschiedliche Präferenzen formulieren, ankreuzen, wie auch immer, könnte, dann muss er in der Lage sein, ein zurechnungsfähiger Akteur zu sein, der diese oder jene Präferenz haben könnte. Also, wir würden niemanden fragen, ob er sich dafür entschieden hat, dass Russland die Ukraine überfällt, weil das nicht in den eigenen Präferenzvorrat passt. Man würde immer Dinge fragen, bei denen wir uns vorstellen können, und das muss ein Beobachter, der wissenschaftlich beobachtet, machen, dass diese Präferenzen einen Unterschied in einer bestimmten Situation machen. Sonst wäre der Datensatz, den man davon bekommt, sinnlos. Also, was sieht ein Beobachter? Es gibt soziologische Theorien, die sich mit dieser Frage ja beschäftigen, was man da eigentlich sieht. Also um nur drei zu nennen, die ich selber sympathisch finde. In der Organisationsforschung spricht man von bounded rationality, also von einer Form der Rationalität. Es geht um Organisationssoziologie. Eine Form der Rationalität, die insofern begrenzt ist, als die Mittel begrenzt sind, die ich als Mitglied einer Universität habe, um bestimmte Dinge zu tun, und die von der Intransparenz geprägt sind, des Prozesses, den ich dort beobachte. Das heißt, ich kann nur mit den Mitteln arbeiten, die ich selber habe. Niklas Luhmann aus Bielefeld würde von Paradoxien reden, zu denen ich gleich noch etwas Genaueres sage. Und Heinz von Foerster, kein Soziologe, hat den wunderbaren Satz gesagt, dass man nur über die Dinge entscheiden kann, über die man eigentlich gar nicht entscheiden kann. Das ist der Satz, den ich vorhin auch schon gesagt habe. Wenn ich weiß, was ich tun muss, muss ich nicht entscheiden. Und das Spannende ist, die Bibliotheken sind voll mit Materialien darüber, wie man besser entscheidet. Und man kann vor allem viel Geld damit verdienen, Leuten dabei zu helfen, besser zu entscheiden. Also, die ganze Beratungsbranche ist im Prinzip nichts anderes als der Versuch, wie soll man sagen, mit symbolischer Kommunikation eine Sicherheit zu formulieren, mit der eigenen Unsicherheit umzugehen. Psychologen würden immer sagen, Sie kennen das ne, wenn es einem schlecht geht, du musst selber wissen, was du willst. Also man geht ja dahin, weil man nicht weiß, was man will, aber man muss es selber wissen. Das heißt, du musst das irgendwie zurechnungsfähig für dich selber machen. So, und jetzt, was mich besonders interessiert, das ist die Frage mit den Paradoxien. Ich bin sehr verliebt in Paradoxien. Nicht weil das so… weil man damit so schöne Sätze sagen kann, die ich gleich auch sage, sondern weil darin eigentlich das Grundproblem sowohl von Handlungen als auch von Bedeutungen, als auch von Entscheidungen liegt. Nämlich die Paradoxie, eine empirische Paradoxie, dass, wenn wir genau hingucken, Entscheidungen immer mit Entscheidungsprämissen zu tun haben, die vor der Entscheidung schon da waren. Also, wir entscheiden nicht im luftleeren Raum. Es kommt auf der nächsten Folie noch mal genauer. Sondern Entscheidungen sind, empirisch betrachtet, immer Entscheidungen in einem Raum, in dem Entscheidungsalternativen bereits institutionell vorbereitet sind. Und das ist deshalb paradox, weil die Einheit der Unterscheidung von A oder B eben nicht A oder B ist, sondern die Einheit dieser Unterscheidung. Beispiel… Ich nehme extra unterkomplexe Beispiele, damit man es gut erklären kann. Wir wollen den Klimawandel überwinden. Also ich nicht, ich bin heute von München nach Paderborn geflogen. Aber… Wir wollen das eigentlich aus Zeitgründen. Ich habe heute Morgen schon Vorlesung gehalten. Und wie machen wir das? Es wird gesagt: Handelt endlich! Also jeder, der viele Bücher verkaufen will, schreibt darüber, handelt endlich, entscheidet endlich. Und interessant ist, wenn wir uns empirisch angucken, worüber man entscheiden soll, ist im politischen Raum, ich werde darüber nachher noch was sagen zu politischen Entscheidungen, ziemlich klar, dass man sich entscheidet, entweder für mehr Staatstätigkeit oder weniger Staatstätigkeit. Sie kennen die Diskussion. Also, man sagt, wir müssen über Verbote, über Gebote, über klare Regeln, Und so weiter, und so weiter, das machen. Oder wir sagen, wir müssen eine freie Gesellschaft sein, in der wir neue Lösungen nur dann finden, wenn wir die Menschen nicht eingrenzen, sondern ihnen … ja, Sie können das mit Politiker- und Parteigestalten ganz gut, wahrscheinlich, verbinden. Und ich glaube, es ist empirisch nicht ganz falsch, wenn ich sage, dass dieser Diskurs sich um diese beiden Dinge dreht. Jetzt ist die interessante Frage, wofür entscheidet man sich? Die Entscheidungsprämissen sind bereits da und das ausgeschlossene dritte… Also, zum Beispiel, vielleicht müssen wir nicht über mehr oder weniger Staatstätigkeit nachdenken, sondern über andere Staatstätigkeit, die Diskussion gibt es auch. Eine der größeren Parteien, die zurzeit gerade regieren, versucht das gerade hinzukriegen, eine semantische Form dafür. Geht nicht so richtig, ist schwierig, aber man versucht’s. Das ausgeschlossene Dritte würde die Paradoxie sichtbar machen, dass wir Entscheidungsprämissen zwischen A und B haben. Und dieses Problem, das kann man tatsächlich nur empirisch lösen, also mit empirisch meine ich jetzt, wir können empirisch beobachten, wie Entscheidungsprämissen sich so institutionalisieren, dass wir eigentlich nicht aus diesen Gedankenraum von Alternativen rauskommen. Die Paradoxie des Entscheidens, würde ich sagen, lässt sich nicht logisch auflösen, sondern nur operativ und empirisch. Die Paradoxie des Entscheidens besteht darin, dass die Entscheidungsprämissen, die selbst nicht Gegenstand von Entscheidungen sind, sondern von evolutionären Prozessen, die man auch übrigens Entscheidungen zurechnen kann, aber dann sind es auch wieder Entscheidungen. Dass dies sich selber dadurch stabilisiert, dass es in der Zeit stabil bleibt. Wenn man sich die Geschichte der politischen Konflikte seit Mitte des 19. Jahrhunderts anguckt, zumindest in westlichen Industriegesellschaften, nicht weltweit, das ist klar. Aber in westlichen Industriegesellschaften haben wir doch eine ganz interessante Form der Präferenzbildung institutionalisierter Natur in ganz bestimmten politischen Gestalten. Also der Normalfall, viele von Ihnen sind so alt, dass Sie sich noch daran erinnern, dass wir, also ich darf das sagen, weil ich auch so alt bin, dass wir eine Mitte-rechts und eine Mitte-links Partei in westlichen Industriegesellschaften hatten, die sich vor allem aneinander orientiert haben und dann Lösungen präsentiert haben, für die sie jeweils die andere Seite brauchten. Und dann gab es natürlich neben Mitte-rechts auch noch irgendwie Sachen, die, wie sagte Franz Josef Strauß mal, rechts von uns darf es nicht, hat nicht geklappt. Und auf der linken Seite gab es immer so ein bisschen mehr, wurde aber eingemeindet. Klappt inzwischen auch nicht mehr. Und wir sind in Deutschland ja zumindest so, dass wir uns noch daran erinnern, dass die Balken, die immer kleiner werden, früher mal groß waren. Ich glaube, die farblichen Formen der Beobachtung machen die noch größer, weil wir daran gewöhnt sind, dass die mal groß waren. Und das gilt ja für viele, Formen, die wir in der Gesellschaft haben, dass institutionalisierte Konflikte die Dinge wunderbar integrieren. Und man damit Entscheidungsprämissen hat, die nicht Gegenstand der Entscheidung sind. Sie wissen, wie schwer das war, neue politische Spieler zu etablieren. Das hat dann geklappt. Das wäre eine empirische Frage, warum eigentlich? Also, das gilt auch für Bewusstseinstätigkeit. Wie schaffen wir das eigentlich, Intentionalität zu haben? Also, die Intentionalität unserer Wahrnehmung. Die Wahrnehmungsphysiologen zeigen das sehr schön, ist eine wirklich wundersame Sache, weil physikalisch nehmen wir viel mehr wahr, als wir intentional wahrnehmen. Also, wenn ich jetzt nicht Sie alle sehen würde, sondern mir Gedanken machen würde, ob der Winkel dieser komischen Sachen da an den Stühlen.. nicht Stühle, wie heißen die? Tische. An den Tischen bei allen Dingen gleich ist, das könnte ich ja jetzt prüfen, dann könnte ich den Vortrag nicht halten. Das wäre vielleicht kein Schaden, aber es wäre zumindest nicht möglich, das zu tun, was geplant war. Und halten Sie das nicht für eine Dusseligkeit oder für ein blödes Beispiel? Es gibt Krankheitsbilder, in denen Menschen nicht in der Lage sind, diese Art von Intentionalität hinzukriegen. Und wir haben die Intentionalität dadurch hingekriegt, dass wir das in der Zeit entparadoxien. Wir gehen in Räume und sehen Leute. Dabei sind noch viel mehr Sachen da als Leute. Jemand, der solche Tische baut, der sieht die Leute gar nicht. Der sagt, das sind aber interessante Tische, ich würde sagen späte 70er Jahre, irgendwie sowas wird er da wahrscheinlich sagen, ne? Späte 70er, orange, vielleicht ist das frühe 70er, Ich weiß es nicht. Also, das heißt, es wird in der Zeit produziert dasselbe, Präferenzen, die uns selber unsichtbar sind. Für die Soziologen und Soziologinnen unter Ihnen, es gibt eine Kulturtheorie in der Soziologie, die das stark gemacht hat, nämlich die von Talcott Parsons im allgemeinen Handlungssystem. Der wird ja irgendwie nicht mehr richtig gelesen, was ich sehr schade finde, zumindest im Hinblick auf dessen Kulturbegriff, der sehr schön beschreibt, dass kulturelle Selbstverständlichkeiten nur funktionieren, weil sie latent bleiben, also unsichtbar. Also, sie bleiben nicht immer völlig latent und man kann sie sogar beobachten, aber es ist schädlich. Also schädlich zumindest für Stabilität. Die Entparadoxierung in der Zeit produziert eigentlich nichts anderes als eine Welt, die stabiler ist als unsere Selbstbeschreibung. Also auch das kann man wiederum in unterschiedlichen Disziplinen, man muss ja nicht nur soziologisch machen, psychologisch ist das ganz interessant, wie schwer es uns fällt, Gewohnheiten loszuwerden. Wir sind sehr träge Systeme. Also, haben Sie schon mal versucht, Ihr Leben zu ändern? Ich auch. Und interessanterweise besteht die Trägheit darin, dass wir die Dinge wiederholen. Die empirische Sozialforschung macht ja im Prinzip nichts anderes, als sich darüber zu wundern, wie musterhaft und erwartbar in einem System, in dem prinzipiell Unterschiedlichstes möglich ist, sich die Dinge wiederholen, obwohl wir anderes könnten. Soziale Ordnung hängt davon ab, dass wir unkoordiniert uns an Skripte halten, die nirgendwo stehen. Das ist ja eigentlich ein wundersames Ding. Und wir würden jetzt auch hingehen und sagen, wenn wir das Entscheidungen zurechnen würden, dann wäre das… Also, wenn ich jetzt sagen würde, das finde ich total super, wie Sie da sitzen, wie machen Sie das? Dann können Sie darauf gar keine Antwort geben, weil das spätestens dann unmöglich wird. Das kennen wir auch, wenn wir auf Verhalten, das gewissermaßen in der Verhaltensdisposition vorbewusst ist, hingewiesen werden, wird dieses Verhalten uns selber peinlich. Also ich mache jetzt hier so Gesten und wenn man mich auf meine Gesten aufmerksam machen würde, würden die Gesten sich wahrscheinlich schon selber ändern. Deshalb lasse ich das lieber darüber weiterzureden. Also, Unsicherheit ist gewissermaßen etwas, das absorbiert wird dadurch, dass die Dinge wiederholt werden. Sie kennen den schönen Begriff aus der Organisationssoziologie der Unsicherheitsabsorption. Und dass man ihn nur in der Organisationssoziologie verwendet, ist eigentlich schade. Weil soziale Ordnung ist Unsicherheitsabsorption. Nächster Punkt. Ich wollte über Entscheidungsalternativen reden. Tue ich auch. Ich sage den Satz noch mal, den ich gerade gesagt habe: Entscheidungen finden in einem strukturierten Raum statt, in dem Entscheidungsalternativen vorkommen. Die Paradoxie des Entscheidens besteht darin, dass die Alternativen die Einheit der Unterscheidung sind, die die Entscheidungsgrundlage bietet. Und jetzt kommt das empirische Problem, wie sich denn eigentlich, da zitiere ich noch mal diesen Bielefelder Soziologen, wie Systeme, die sich selbst beobachten können, die dabei auftretenden Paradoxien invisiblisieren, unsichtbar machen. Das ist eine Figur, die kennen wir bereits aus der Bewusstseinsphilosophie. Das ist gar nichts Neues. Das ist der Versuch zu beschreiben, dass ein System, das sich selbst beschreibt, schon dadurch paradox wird, dass es zugleich dasselbe und ein anderes ist. Also ich beschreibe mich selbst, bin dadurch selbst immer inkomplett, was im Übrigen, Silke [Schwandt], wir haben darüber schon mal gesprochen, ich werde am Ende auch noch einen Satz, wenn die Zeit ist, dazu sagen, was in technischen Systemen, die selber etwas wahrnehmen, ein großes logisches Problem produziert, das dann durch Zeit eine Form bekommt, die wir in anderen Theoriesprachen Pfadabhängigkeiten nennen. Warum ist der beste, der schlauste Bewusstseinsphilosoph Edmund Husserl? Weil er diese zeitliche Dimension in die Form der Retentionalität des Bewusstseins eingebaut hat und damit beschreiben kann, dass wir davon abhängig sind, dass sich unsere eigenen Gedanken in uns bewähren. Gedanken, die sich… Also, Gedanken ist nur ein Symbol für Ereignisse im Kopf. Und die, die sich nicht bewähren, sind entweder Information oder Störung. Und meistens sind Störungen von hohem Informationswert. Das Latenthalten dieser Bedingungen ist die Bedingung für kompetentes Entscheiden. Also gucken Sie sich mal kompetente Entscheider an, kompetente Entscheider produzieren mehr Sicherheit als da ist. Man kann das sehr schön an der Geschichte der Semantiken von Beratung beobachten. Also, der klassische Berater würde ja immer hingehen und sagen: Ich weiß es besser als du, tu jetzt das. Das funktioniert natürlich so nicht. Das ist ja auch eine Hybris, die nicht funktionieren kann. Aber der Entscheider, der darüber entscheidet, wie er einen Entscheider berät, muss sich die Frage stellen, wie dieser Entscheider eigentlich eine Form findet, das latent zu halten, was die Entscheidung immer zu einer Unsicherheitsform macht. Es hat eine lange Konjunktur gegeben, das psychologisch zu machen. Du musst das aushalten. Kennen Sie, ne? Oder du musst eine starke Persönlichkeit sein. Der alte Persönlichkeitsbegriff von Max Weber hat da eine… Also, “mannhaft die Forderungen des Tages” hieß es, glaube ich, in dem Vortrag Wissenschaft als Beruf bei Max Weber, in München gehalten übrigens. Also, total spannend eigentlich, weil man dort sozusagen sieht, da ist jemand, der… Wir denken an alte, weiße Männer, die sich ihrer Selber sicher sind, die mehr Sicherheit zeigen müssen, als da ist, damit das funktioniert. Das ist das Latenthalten. Kompetenz ist meistens eine Einschränkung. Wir machen selber bei uns am Lehrstuhl Forschung über die Kommunikationsform in Ethikkommissionen und ähnlichen Boards, in denen Expertinnen und Experten sitzen, die zu bestimmten Themen sich beraten. Und es ist hochgradig spannend. Da sitzen natürlich die Besten nur, ist klar. Also, so eine SED-Sache ist das: “Wo wir sind, ist vorn.” Die sind sozusagen in der Lage, klare, eindeutige Sätze über die Dinge zu sagen, die sie da tun. Und dann wäre es ja total langweilig, wenn man jetzt da Leute reinsetzen würde, die von vornherein schon Antipoden sind. Antipoden stabilisieren sich gegenseitig. Wenn ich A sage, dann sage ich natürlich A, weil du B sagst das, das ist langweilig. Viel spannender ist es, wenn die Expertisen sich ein bisschen unterscheiden, was in solchen Boards passiert. Unterschiedlichster Natur. Und wenn sie sich ein bisschen unterscheiden, fällt den Experten in der Zeit auf, dass der gleiche Sachverhalt in einer geringabweichenden Form eine neue Form bekommt. Ich bin selber mal vom Deutschen Ethikrat gebeten worden, deren Arbeit zu evaluieren, und zwar nicht in dem Sinne, ob sie gute Entscheidungen oder schlechte treffen. Das kann ich nicht beurteilen. Sondern, ich sollte beurteilen, wie sie eigentlich arbeiten. Also, die fragten wirklich, was machen wir? Weil es ja nicht so ist, dass die am Ende Papiere schreiben, in denen die Wahrheit steht. Das wissen die ja auch. Ja, das sind Empfehlungen, die Wahrscheinlichkeiten formulieren und so weiter. Und meine Antwort dazu war eigentlich nichts anderes als zu sagen, dass Expertise gleichzeitig verunsichert wird und damit ermöglicht wird, weil man gewissermaßen bestimmte Dinge, die latent waren, zeitweise aufheben kann, um dann zu Ergebnissen zu kommen. Ich habe das an einem Beispiel ausführlich gemacht. Der Deutsche Ethikrat hat mal, ich glaube, das war sogar noch der Nationale Ethikrat, also der, der von Gerhard Schröder damals eingerichtet wurde. Ich weiß nicht, ob es der oder der war, es ist auch egal. Es ist aus der Erinnerung jetzt nicht ganz klar. Die haben sich mit den Personenstandsfragen bei Intersexuellen beschäftigt und das war hochgradig interessant, weil das ein Feld ist, in dem die Expertise schon deswegen schwierig ist, weil es wenig Tradition gibt, damit umzugehen. Und die sind zu Ergebnissen gekommen, auf die niemand selber gekommen wäre. Hoch umstritten übrigens, vor allem bei den Betroffenen hoch umstritten. Aber sie haben funktioniert. Funktioniert, würde ich sagen, heißt nur, dass man mit den Latenzen umgehen konnte und eine Form von Expertise entstanden ist, die wir aus anderen Zusammenhängen so nicht kennen. Man könnte fast andersrum sagen: Je rationaler das Entscheidungskalkül, desto unmöglicher ist die Entscheidung. Also rationaler heißt jetzt hier je eindeutiger, weil dann ist es schon entschieden. Das ist das Problem klassischer Entscheidungsformen, in denen immer schon klar ist, was denn eigentlich die Formen sind. So, nächster Punkt heißt Entscheidungspraktiken. Heißt also… Jetzt interessiere ich mich für die Fragen, wie man das empirisch eigentlich macht mit dem Entscheiden. Also, in welchen Situationen. Entscheidungen… Muss ich da sensibler drücken oder fester? [Problem mit der Fernbedienung] Himmel noch eins, so. Also, Entscheidungen passieren durch latenthaltende Entscheidungsbedingungen. Also, wir benutzen bestimmte Semantik. Die Semantik der Liebe, zum Beispiel, als Entscheidungsgrund für Beziehung. Das muss latent gehalten werden. Also zum Beispiel, muss latent gehalten werden, wie wir in der empirischen Sozialforschung rekonstruieren können, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass sich bestimmte Leute anfangen, gegenseitig zu lieben und so was. Also, das muss alles latent gehalten werden. Das heißt, wir leben in einer Simulation einer selbsterzeugten Sicherheit und Unsicherheitsabsorption. Ich will jetzt ein paar Beispiele bringen, welche Arten von Praktiken dabei helfen. Und ich benutze dafür die Sinndimensionen des Sozialen, des Sachlichen und des Zeitlichen. Man könnte auch andere nehmen, aber ich nehme jetzt mal die. Also, sozial. Man produziert Stellen in Organisationen, die Entscheidungskompetenz haben. Oder Hierarchien sind unglaublich gut dafür. Hierarchien sind deshalb gut, weil sie asymmetrisieren, wer was latent halten muss. Oder Zuständigkeiten. Das ist in Organisationen eine der probatesten Mittel zu sagen, dass unterschiedliche Leute Unterschiedliches entscheiden. Das Problem ist, dass die unterschiedlichen Entscheidungen zusammenpassen müssen. Und darüber wird auch entschieden. Noch wichtiger sind Rituale. Also, wenn Sie mal gesehen haben, in welche Art von Ritualen man zum Beispiel Hochschulgremien wählt oder Vorstände in Unternehmen oder Regierungen, dann hat das ja was stark Rituelles. Oder rechtliche Entscheidungen, die verkleiden sich sogar. Das ist ja nicht zufällig, dass das passiert. Am liebsten mag ich es in Großbritannien mit den Perücken, würde mir stehen, glaube ich. Also, das ist sozusagen eine Form, bei der der entscheidende Satz sozial gestützt wird. Und das liegt vor allem daran, dass das nicht jeder machen kann. Also das sind dann ausgewählte Personen, ausgewählte Positionen, ausgewählte Stellen, ausgewählte Formen. Und wenn Sie jetzt sagen, das ist ja banal, dann würde ich sagen das ist aber die Form, mit der wir umgehen mit diesen unsicheren Entscheidungen. Und was man empirisch schon beobachten kann, das ist, dass diese Stellen, Hierarchien, Rituale und symbolisches Handeln immer mehr unter den, sagen wir mal, den Druck kommen, dass es mehr Nein- Stellungnahmen dazu gibt. Also, wir fragen dann zum Beispiel: Werden Entscheidungen besser, wenn die Positionen, von denen hier die Rede ist, diverser besetzt werden? Also, Männer und Frauen, Schwarze und Weiße, Schlaue und Dumme. Mit schlau und dumm meine ich Experten und die, die gar nichts davon wissen. Großes Thema. Also, diese Praktiken helfen nicht dabei, eine bessere Entscheidung zu treffen. Sie helfen aber dabei, der Entscheidung eine bestimmte Würde zu verleihen. Und das wären sozusagen Formen, die jetzt eher auf der sachlichen Ebene eine Rolle spielen. Expertise habe ich schon genannt. Also, diese Gesellschaft ist geradezu verliebt in Expertinnen und Experten. Und wenn man einmal angefangen hat, Experte und Expertin zu sein, dann… Ich mache so was tatsächlich viel und ich bin altmodisch und will eigentlich, wenn ich als Experte irgendwo auftrete, über Dinge nur reden, von denen ich was weiß. Ich habe in der Pandemie, du hast das vorhin erwähnt, ja, wirklich viel gemacht, total spannend, weil das die einzige Expertise, die ich als Soziologe einbringen konnte in vielen dieser Runden war… Ich habe die Kanzlerin beraten und ihren ehemaligen Ministerpräsidenten Armin Laschet und in Bayern auch so ein paar… Dass wir sagen würden, das Interessante an der Pandemie war, was Unsicherheit produziert hat, waren die Zielkonflikte der unterschiedlichen Instanzen der Gesellschaft. Was medizinisch richtig ist, hat ökonomisch irgendwie und im Bildungssystem doofe Folgen. Und jetzt würden wir wahrscheinlich so als sozialwissenschaftlich irgendwie einigermaßen kontaminierte Leute sagen: Na ja, was denn sonst? Aber das war in einer bestimmten Situation eine Information, also Expertise. Und das Interessante ist, dass die Expertise sachlich nie so auftritt, dass sie die Bedingungen der eigenen Sätze mitliefert, sondern mit einer großen Sicherheit das formuliert. Kann ich. Lange Sätze. Je länger, desto besser. Wissenschaft, also Wissen und Wissenschaft, ist eine dieser Formen. Die Öffentlichkeit war in der Pandemie unglaublich nervös auf einmal, dass man festgestellt hat, wie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind. Also, wir haben uns doch nicht darüber gewundert, dass Epidemiologen und Virologen unterschiedliche Auffassungen über den selben Datensatz hatten, oder gesagt haben: Wir haben eigentlich nur aus Dänemark angemessene Daten bekommen. In Deutschland gab es keine entscheidenden richtigen. Bis heute übrigens nicht. Aus verschiedenen Gründen, die nichts mit den Daten zu tun haben, sondern mit einer bestimmten Form von Wissenschaftspolitik. Also, uns kann das nicht wundern. Also, die Wissenschaft kann natürlich nichts sagen, aber die Erwartung an Wissenschaft ist, dass die Wissenschaft klare Sätze sagt. Das hat Unsicherheit produziert. Warum? Weil Latentes sichtbar geworden ist, wie stark wissenschaftliches Wissen abhängig ist von den eigenen Voraussetzungen, die sie selber produziert. Der böse Satz, den wir in der Soziologie gerne sagen, dass die empirische Sozialforschung vor allem in einer Welt selbsterzeugter Daten lebt. Das ist so. Das ist keine Kritik daran, sondern die Daten produziert man selbst. Übrigens, in Parenthese gesagt, in einer Zeit, in der Daten auch außerhalb der Sozialforschung anfallen, wird es ein noch größeres Problem, wie man eigentlich mit diesen Daten dann umgehen soll in der Forschung. Aber Sie kennen die Diskussion um Theorie, große Forschung, mit irgendwelchen Daten von Big Data und so weiter, ich schließe die Parenthese wieder. Wenn wir das ernst nehmen, dann stellen wir fest, dass in solch einer Krise wie der Pandemie deutlich wurde, wie selbsttragend und paradox die Aussagen tatsächlich sind, wenn gleichzeitig mitgeliefert wird, ich kann das nur aufgrund der Daten machen, die ich da gerade habe. Und dann gibt es natürlich Akteure, die das anders beobachten. Also, dass man irgendwie zwei attraktive Virologen im Land hat, die man irgendwie in so einer High Noon Geschichte aufeinander jagen kann, ist natürlich dann perfekt. Da war allerdings mehr Eindeutigkeit als man denkt. Dann Konditionalprogramme kommen in Organisation und in vielen Zusammenhängen vor. Konditionalprogramme sind sozusagen Formen, in denen man, wenn etwas passiert, weiß, was man tun muss. Also, das ganze Rechtssystem besteht eigentlich aus Konditionalprogrammen, hatten wir auch in der Pandemie doch wunderbar gesehen. Da entstand Unsicherheit, dass es keine Konditionalprogramme gibt, für die Frage, ob eigentlich zwei unterschiedliche, durch Grundrechte verbürgte Ziele, die sich operativ im Moment widersprechen, rechtlich aufgelöst werden können. Und dann gibt es Gerichtsentscheidungen, auf meistens unterer Ebene, die sich widersprechen. Spricht das für oder gegen das Rechtssystem? Ich meine, dafür ist es gemacht, dass es unterschiedlich entscheiden kann. Macht es übrigens den ganzen Tag, wird nur meistens nicht beobachtet. In der Pandemie musste man zugucken. Riesenproblem. Oder man hat sozusagen Konditionalprogramme in… Na, wie heißt es? Im Bildungssystem gehabt. Das wichtigste Konditionalprogramm im Bildungssystem ist die Leistungsmessung. Das kennen wir auch, wird sogar gesetzlich vorgeschrieben, wie das funktioniert. Das sind hoheitliche Akte von verbeamteten Lehrern, die Noten geben. Und so weiter und so weiter. Mit einem Stempel. Und auf einmal war das nicht möglich, weil Prozesse stattgefunden haben, in denen das nicht funktioniert hat. In denen man zum Beispiel festgestellt hat, wie schnell Schülerinnen und Schüler das Lernen verlernen, wenn sie nicht jeden Tag in die Schule gehen. Das Wichtigste aber sind die Verfahren. Verfahren sind eine der besten Formen von Unsicherheitsabsorption. Das bekannteste Verfahren in der Demokratie ist die Mehrheitsentscheidung. An die haben wir uns unglaublich gewöhnt. Wenn wir nicht weiterwissen, machen wir eine Mehrheitsentscheidung. Und niemand würde behaupten, dass die Mehrheit es besser weiß als die Minderheit. Außer im Konklave, weil da der Heilige Geist ja die Sachen macht, aber sonst nirgendwo. Und selbst wenn man in der Sozialphilosophie, Jürgen Habermas hat das eigentlich immer sehr schön beschrieben, wo man sagen würde, wenn ein angemessener öffentlicher Diskurs stattfindet, dann bricht sich das Richtige natürlich schon durch den Diskurs Bahn, und dann werden die Mehrheiten und Minderheiten auch loyal dazu bleiben. Und so weiter. Das ist aber ein bisschen mehr Magie als man so denkt. Vor allem in Konflikten, in denen es um was geht. Wo es zum Beispiel um Interessen geht. Sind Interessen eigentlich, wie soll man sagen, sachlich entscheidbar? Ist mein Interesse schlechter als deins? Schwer zu sagen. Also, Verfahren sind ganz, ganz entscheidend für die Frage von Unsicherheitsabsorption. Also, wenn es politisch während der Pandemie, ich nehme jetzt mal das Beispiel, man kann auch viele andere Sachen nehmen, aber das ist ja jetzt gerade sehr aktuell, also eine politisch wirklich folgenreiche Geschichte gibt, dann ist es die Bezweiflung der demokratischen Verfahren. Zum Beispiel zu behaupten, dass es im Bundestag keine Opposition gab. Ich meine, gab es ja auch zum Teil nicht, außer der AfD, die man aber nicht als Opposition ernst nimmt. Aus guten Gründen. Wir sind unglaublich daran gewöhnt, dass es fast eher symbolische Formen sind, in denen wir die Dinge für sicher halten. In denen zum Beispiel Macht ausgeübt wird, ohne dass die Macht permanent durch Gewalt gestützt werden kann. Auch das ist eine Unsicherheitsabsorption. Also, 80.000 Menschen in einem Stadion. Wir wollen jetzt nicht sagen, welches, nein. Sie wissen ja, wo ich Abitur gemacht habe, habe ich vorhin gesagt. Und wenn 80.000 Leute auf jemanden losgehen, dann geht da ordentlich was los. Und da gibt es manchmal bewaffnete Polizisten, die da stehen. Wie viele? Also, sagen wir mal, wenn es ganz viele sind, sind es 100. Die können gegen die 80.000 nichts machen. Aber es produziert Sicherheit bis zu einer bestimmten Schwelle. Ich war, paar Tage nach diesem schrecklichen Angriff auf eine Pariser, wie heißt es, Diskothek oder Konzert was da war, in Paris. Und Pariser Polizisten und Militär, die sehen anders aus als in Deutschland. Wir haben irgendwie diese kleinen Gewehre, die haben so richtige Dinger und die sehen anders aus. Das ist hochgradig interessant, wie man sozusagen über symbolische Formen versucht, Uncertainty [engl. für Unsicherheit] zu minimieren, zum Teil mit dem gegenteiligen Effekt, aber das ist was anderes, weil die Latenz aufgehoben wird. Also, das wären die sachlichen Fragen. Zu den sachlichen gehört übrigens auch noch, das habe ich vergessen reinzuschreiben, das kommt nämlich jetzt beim Zeitlichen, aber das gehört ins Sachliche rein: Fristen. Fristen sind ganz toll für das Entscheiden. Und zwar deswegen, weil man damit irgendwann entschieden hat. Also, zeitliche Praktiken sind Wiederholung. Wir wissen, wie man das macht, immer wieder dasselbe. Die Entparadoxisierung in der Zeit hatte ich genannt. Gewohnheit. Auch das ist empirisch leicht zu rekonstruieren. Also, in der Betriebswirtschaftslehre gibt es Versuche zu zeigen, wann Unternehmen eigentlich in Schwierigkeiten geraten. Und die geraten eigentlich meistens eher dann in Schwierigkeiten, wenn sie sich ihrer Entscheidung zu sicher sind. Also Gewohnheit. Fristen hatte ich genannt. Und Disruption. Also, Leute wie wir, die vor allem in sehr stabilen Verhältnissen leben, sind unglaublich verliebt in Disruption, weil sie uns nichts anhaben kann. Aber das ist auch eine Form, das wäre so eine Praktik. Jetzt muss alles anders werden. Je lauter man sagt, jetzt muss alles anders werden, desto sichtbarer macht man die Bedingungen und desto weniger Wirkung wird das wahrscheinlich haben. Auch das kann man übrigens sehr schön sehen, wenn man sich gesellschaftliche Prozesse anguckt, an denen wirklich sich etwas verändert, dass es viel schwieriger ist, das auf Entscheidungen zuzurechnen. Also der Migrationsforscher Aladin El-Mafaalani, mit dem ich gut befreundet bin, der hat ja diese wunderbare These zu sagen: Das Spannende an der Migrationsentwicklung in Deutschland ist, dass sich sozusagen durch gesellschaftliche Evolution… Da gibt es natürlich viele Entscheidungen, die irgendwann auch mal getroffen werden. Aber eigentlich, durch eine evolutionäre Entwicklung jetzt Migrantinnen und Migranten in Positionen vorkommen, für die sie eigentlich nicht vorgesehen waren in Deutschland. Also, die Nachkommen von Arbeitsmigranten studieren jetzt auf einmal. Was in Deutschland natürlich unwahrscheinlicher war, weil die Klientel, die als Arbeitsmigranten nach Deutschland kam, auch wenn sie Deutsche gewesen wären, kaum ins Bildungssystem ganz oben gespült worden wären. Aber jetzt sind sie da. Also die Formel ist: Eine Frau mit Kopftuch, die die Universität putzt, hat weniger Informationswert als eine, die womöglich Professorin wird. Also, dazwischen gibt es jetzt auch noch so ein paar Sachen. Und was er damit sagen will, ist eigentlich, dass die evolutionären Veränderungen womöglich viel nachhaltiger sind, weil sie nicht auf Entscheidungen zurechenbar sind. Die AfD, das sind ja arme Leute, weil sie irgendwie bestimmte Dinge, die evolutionär sich verändert haben, auf klare Entscheidungen zurechnen wollen. Die sagen, das ist eine Strategie der Umvolkung. Sie kennen diese Semantik. Es ist schrecklich, allein das Wort in den Mund zu nehmen. Aber es ist unglaublich schwierig, hier Entscheidungen oder Entscheidungspunkte zu haben, denen man das zurechnen kann. Also, wenn man das zusammenfasst, könnte man sagen: Pleonasmus, immer Unsicherheit. Wie geht so eine Gesellschaft eigentlich mit diesen Unsicherheiten um? Und sie macht das mit, ich habe ein paar logische Dinge genannt, und ich habe jetzt hier ein paar Praktiken genannt. Und ich glaube, dass, wenn man diese Praktiken wirklich ernst nimmt, man auch ein Maß dafür hat, entscheiden zu können, wo uns eigentlich auf einmal Entscheidungen als unmögliche, als unsichere, als kontingente und wie auch immer, erscheinen. Also die Frage: Wer entscheidet? Die Frage: Wo entschieden wird? Mit welchen Mitteln man das macht? Wo Konditionalprogramme entstehen? Wer über die Konditionalprogramme entscheidet? Was ja wieder sozusagen die Sache verkompliziert. Das sind dann Dinge, die man empirisch sich angucken kann. Wenn ich über dieses Thema forschen würde, würde ich mir diese Dinge angucken. Also, ich würde mir die Dinge angucken, an den Formen, wie die Unsicherheitsabsorption empirisch passiert, und dann empirisch die Mittel befragen, mit denen man das macht oder die scheitern. Das Interessante ist ja, wo die Unsicherheit zu groß wird oder wo sie zu klein wird. Zu kleine Unsicherheit ist auch ein Problem, weil man dann immer dasselbe entscheidet. Eine interessante Entscheidungspraktik ist die empirische Sozialforschung, und zwar in dem Sinne, dass wir ja in der empirischen Sozialforschung selber Entscheidungspräferenzen oder Alternativen antizipieren müssen, um damit forschen zu können. Also, sagen wir mal so, naive qualitative Sozialforschung denkt ja, man muss die Leute nur fragen und dann kommen wir an die soziale Wirklichkeit heran. Schlimmer kann man es eigentlich nicht machen. Man sollte dafür kein Steuergeld ausgeben. Ja, es passiert zum Teil. Es ist fürchterlich. Statt sich die Frage zu stellen was sind die Selektionsbedingungen, warum Leute bestimmte Dinge so beobachten und nicht anders. Und in der quantitativen Sozialforschung stellt sich die Frage ganz genauso. Die selbsterzeugten Annahmen, übrigens mit einem hohen qualitativen Anteil, im Hinblick darauf, was man wen eigentlich fragen kann oder welche Daten was repräsentieren, wenn man Daten nimmt, die schon da sind. Also, auch hier eine Praktik, die Rationalität unterstellen muss, um sie unterscheiden zu können. Rationalität heißt ja hier nicht, dass es gut ist oder richtig, sondern… Das kennen Sie alle. So, jetzt will ich das an einem Beispiel mal durchspielen. An der Demokratie. Welches Entscheidungsproblem löst die Demokratie? Das ist eine funktionalistische Frage, also die Frage nach dem Bezugsproblem. Wenn etwas persistiert, so ähnlich habe ich das mit der Digitalisierung auch gemacht, wenn etwas persistiert, muss man davon ausgehen, dass es ein Problem löst. Das ist eine alte Figur aus der Ethnologie … Funktionalismus. Wir haben keine Zeit, das zu erklären. Aber ein Experte würde jetzt sagen, ich weiß genau, wo Sie nachlesen müssen. Das weiß ich wirklich. Und das Spannende ist, der naive Beobachter würde hingehen und sagen, das Grundproblem der Demokratie ist, politische Probleme zu lösen. Also, ich glaube, wenn man auf der Straße rumfragen würde, was soll denn die Politik machen? Die soll die Probleme lösen. Das Problem ist nur… [Problem mit der Fernbedienung] Die Pointe ist immer weg, wenn das nicht funktioniert. Das ist gemein. Machen Sie das? So. Das Problem ist nur, es gibt gar keine politischen Probleme. Also, ohne die Eigenleistung des politischen Systems. Das kann man daran zum Beispiel beweisen, dass wir den Klimawandel noch gar nicht so lange als ein politisches Problem betrachten, obwohl wir das schon länger wissen. Ich weise immer gerne auf Hoimar von Ditfurth hin. Kennen Sie den noch? Die Älteren unter Ihnen bestimmt. Der hat ZDF Sendungen gemacht, Ende der 70er und 80er Jahre. Das einzige, was man heute so nicht mehr machen kann, ist mit solchen Kordanzügen ins Fernsehen zu gehen. Alles andere, was er macht, kann man identisch heute genauso machen. Die ganzen Prognosen, die er gemacht hat, die stimmen alle ganz genau. Auf YouTube kann man das sehen. Das ist wirklich hochinteressant. Das wäre völlig aktuell, wenn das ästhetisch anders aussehen würde. Es ist auch interessant, dass uns das auffällt als Störung, wie diese ästhetischen Formen funktionieren. Also, wir wissen das alles, aber es war kein politisches Problem. Also, wie wird eigentlich ein Problem zu einem politischen Problem? Und die Antwort ist: Indem man es politisch bearbeiten kann. Und was heißt das, das politisch zu bearbeiten? Also, das ist ein interessanter Weg. Es geht zunächst mal um die Überführung gesellschaftlicher Komplexität in lösbare Probleme. Das politische System ist an unlösbaren Problemen nicht interessiert. Also, machen Sie mal Wahlkampf mit etwas, was man nicht entscheiden kann. Also, man kann nicht Wahlkampf machen und sagen: Ich bin Systemtheoretiker, ich weiß genau, das es eine Paradoxie bei der Beschreibung von Problemen gibt, und wir werden es wahrscheinlich in der nächsten Legislaturperiode nicht lösen können, aus dem Grund, weil wir nur die Mitte-rechts die Mitte-links Denkungsart haben und das ausgeschlossene Dritte ausgeschlossen bleibt. Bitte wählen Sie mich. Das wird nicht funktionieren. Also, man müsste es mal ausprobieren, aber ich fürchte, es wird nichts. In Bayern haben wir sogar noch nicht mal eine Mitte-Links-Partei. Also, die ist ganz klein. Da könnte man noch nicht mal mit Alternativen arbeiten. Die CSU sagt immer: “Opposition san mer selber” und das stimmt auch ein bisschen. Also, sie ist nicht interessiert an nicht lösbaren Problemen. Wir haben… Ich war an einem internationalen Forschungsprojekt beteiligt, das hieß Knowledge and Policy. Das war ein EU-Projekt in sieben europäischen Ländern. Ich habe das deutsche Team geleitet. Und wir haben untersucht, wie Wissen im Health and Education Bereich, also Schulforschung, pädagogische Forschung auf der einen Seite, und vor allem Psychiatrie-Reform, das ist das, womit wir uns beschäftigt haben, in policy-fähige Papiere überführt wird. Und dann von diesen Papieren in ministerielle Vorlagen, aus denen man dann Gesetzestexte machen kann. Das ist total interessant. Nicht in dem Sinne, dass man sagen kann, das wird banalisiert. Das wäre banal, das zu sagen, das wird banalisiert. Dass man in so einem Gesetzestext nicht eine Kompilation der Fachartikel reinschreiben kann, ist ja logisch. Das muss man irgendwie in eine andere Form bringen. Interessant war, welche der Themen rausfielen, und zwar waren das all die Themen, die unlösbar waren. Also nicht, dass die Themen, die da drin standen, lösbar waren, sondern sie konnten aber so dargestellt werden, dass sie lösbar sind. Und das ist keine Kritik am politischen System, das wäre ja naiv. Dann müsste man hingehen und sagen, jetzt löst doch auch mal die anderen Probleme, als wären die da. Sondern die formieren die Probleme als lösbare Probleme. Über Entscheidungen kann man eine Menge lernen, nämlich dass das eine sehr selektive Form ist, worüber eigentlich A oder B entschieden wird. Also ist der nächste Schritt die Überführung von Entscheidungsbedarf, lösbarer Probleme, in entscheidungsfähige Entscheidungsalternativen. Das war auch immer toll, vor allem bei der Psychiatrie-Reform war das interessant, dass wenn jemand das in die Hand genommen hat, aus einer bestimmten Partei, man nicht einfach hinschreiben konnte, was man wollte, sondern man musste antizipieren, was die anderen dagegen haben, um sofort das zu argumentieren. Da entstanden dann oft Papiere, die komplementär waren und dann im parlamentarischen Prozess zu einer Form geführt haben, bei der man gar nicht mehr genau weiß, wem man sie jetzt eigentlich zurechnet. Also, der abstrakte, theoretische Satz, den man gerne über das politische System macht, zu sagen, die Aufgabe der Opposition in der Demokratie besteht darin, dass diejenigen, die ohnehin die Mehrheit haben, wenigstens gute Gründe dafür nennen können, was sie entscheiden. Weil sie können es ja auch ohne gute Gründe, weil sie die Mehrheit haben. Und im besten Fall die Entscheidung besser wird, weil sie auf ihre eigenen Gründe hin die Dinge noch mal beobachten müssen. Wird hier kleingearbeitet? Und das kann man dann tatsächlich beobachten. Das heißt nicht, dass die Dinge besser werden. Das heißt, dass man aus dem Problembestand, der da ist, und der wird ja wissenschaftlich auch nur konstruiert, zu entscheidbaren Problemen das macht. Und das ist hochgradig interessant, was für Aggression bei den unterschiedlichen Akteuren entstanden ist. Die Wissenschaftler fanden diese ministerialen Leute alle irgendwie dumm. Und umgekehrt übrigens auch. Professoren, die schreiben Sätze hin, mit denen man nichts anfangen kann. Haben wir immer gehört. Und es stimmt auch. Es entstehen dann manchmal so intermediäre Personen. Ja, also Riester, kennen Sie den noch? Das ist so jemand gewesen, der war in beiden Systemen eigentlich drin und wurde von beiden verachtet, weil er nicht richtig drin war. Bei der Wissenschaft sagte man, das ist keine Wissenschaft mehr. Und bei der Politik sagte man, der kumpelt immer mit den Profs zusammen. Also, das ist jetzt nur so ein symbolisches Beispiel dafür. Also, die Überführung von Entscheidungsbedarf in Entscheidungswege, in Entscheidungsalternativen. Und der Beobachter, der wissenschaftliche Beobachter, muss sich über das “oder” Gedanken machen, also nicht über Lösung A und Lösung B, sondern über das “oder”. Wie wird eigentlich die Entscheidungsalternative konstruiert? Ich habe das Beispiel vorhin genannt mit dem Klimawandel. Mehr Staatstätigkeit, weniger Staatstätigkeit. Das haben wir jetzt bei fast allen Themen im Moment. Das ist unglaublich langweilig. Übrigens wissen alle Akteure, die dabei sind, dass das nicht die Alternativen sind, die sind ja nicht doof. Also, das Interessante ist, dass die öffentliche Rede in der Politik was völlig anderes ist, als Politiker über ihren Prozess reden, wie das in der Wissenschaft ja auch ist. Also, in unseren Papers schreiben wir ja nicht rein, wie arbiträr bisweilen die Datenlage ist. Wir schreiben das natürlich rein, aber in einer Form, die man da reinschreiben kann. Und wie stark die Prämissen von Prämissen abhängig sind. Und so weiter, kennen wir ja alles. Und dann kommt es, zumindest im politischen System, zur Überführung von Entscheidungslternativen in stabile Konfliktsysteme. Das Konfliktsystem, ein Begriff von Niklas Luhmann übrigens, auch soziale Systeme, gibt es auch in anderen Theorien. Das Konfliktsystem zeichnet sich dadurch aus, dass es als System sich selber reproduziert in Alternativen, die das System selber produziert, also das Konfliktsystem wohlgemerkt. Wir haben bestimmte eingeführte Konflikte, in denen man sich gut einrichten kann. Das große Problem von solchen Konfliktsystemen besteht darin, dass alles, was passiert, in die Dynamik dieses Konfliktes hineingezogen wird. Also, Beispiel: Ukraine Krieg. Es gibt viele Leute, die sagen, wir brauchen jetzt Verhandlungen und das kann gelingen, wenn die das machen, die das, die das und die jenes. Also, es sind auch hochmögende Leute, richtige Philosophen, sogar von der LMU. Das war jetzt Polemik, weil Sie wissen, wen ich meine. Und das ist naiv. Das ist deshalb naiv, weil man denken könnte, dass es eine dritte Position außerhalb des Konfliktsystems gibt. Jeder Spielzug, Spieltheoretiker können das wunderbar rekonstruieren, Jeder Spielzug im Spiel ist Spielzug im Spiel. Man muss übrigens nicht an Vernichtungskriege denken, um das plausibel zu finden. Das ist in jedem Ehestreit so. Versuchen Sie im Ehestreit mal zu sagen: Du, Schatz, du wirst gleich jenes sagen und ich das, und das führt in die Katastrophe. So kennen wir doch diese Formen von von Konflikten. Aber man kann das nicht als ausgeschlossene Dritter sagen, das ist Teil des Konflikts. Und ich würde jetzt mal sagen, wenn man das sagt, wird es noch schlimmer, weil das ja Teil des Konfliktsystems ist. Und das macht das politische System. Und zwar, übrigens, zur Befriedung und zur Eskalation gleichzeitig. Eigentlich geht es um eine Vermeidung des Dritten. Und das ist natürlich in Situationen, in denen der Dritte sozusagen empirisch auftaucht, schwierig. So, letzte Folie. Ich habe noch acht Minuten. Es ist alles im Lot. Haben wir jetzt gesteigerte Unsicherheit oder nicht? Also, gibt es gerade mehr Unsicherheit? Man ist geneigt zu sagen: Ja. Ich habe letztens mal versucht rauszukriegen, wie man eigentlich über Krisen reden sollte. Also, wenn man die Literatur sich anguckt über Krisen, dann ist es natürlich nicht zu sagen, was eine Krise ist. Das ist irgendwie, das kann man gar nicht beschreiben. Man kann aber beschreiben, wann etwas als Krise beschrieben wird, und das kann man schon sagen. Also in den Situationen, in denen nicht entscheidbare Dinge völlig unkalkulierbar werden. Also, wenn man so ein normales Leben in einer modernen, komplexen Gesellschaft sich anguckt, dann haben wir ja das große Problem zu lösen, dass es unterschiedliche Anforderungen an unsere Leben gibt. Also, wir müssen Geld verdienen, wir müssen eine Familie oder was familienähnliches haben. Es gibt womöglich noch eine Generation jünger als wir und eine Generation älter als wir. Man hat ein zeitliches Problem im Hinblick auf Karrieren. Man lebt in Liebesverhältnisse mit exklusiven Ansprüchen an den anderen, wohl wissend, dass die nicht so exklusiv sind und so weiter. Sie kennen so ein Leben. Unterschiedlichste Ansprüche, die gleichzeitig auf einen niederprasseln. Und die muss man zusammenbringen. Und wenn das nicht gelingt, dann erleben die Leute das als Krise. Auch da war die Pandemie ein wunderbares Beispiel. Sie kennen die schöne Familienideologie, die man gerne so nach dem vierten Advent hat: Wie schön, wenn die Familie immer zusammen ist. Wir werden es nächste Woche sehen, wie es ist. Jetzt hatten wir sozusagen genau das in der Pandemie. Die Familie war immer zusammen und haben festgestellt, gibt es inzwischen auch Untersuchungen dazu, wie belastend das ist. Dass Familiensysteme davon leben, dass die Familienmitglieder zeitweise woanders sind, die Eltern bei der Arbeit, die Kinder in der Schule. Dann gibt es noch Freizeit. Und so weiter. Und das hört sich jetzt wieder wie ein banales Beispiel an, aber das ist es nicht, sondern das ist sozusagen die Unterbrechung einer Routine, die als Routine eigentlich nicht sichtbar wird. Wir stöhnen alle, dass wir dahin müssen und dahin müssen. Man muss nach Paderborn fliegen und einen Vortrag halten, und morgen ist das und so weiter. Das ist irgendwie alles Mögliche, das hält eigentlich den Laden zusammen. Und ein anderes Beispiel ist, wenn man merkt, dass Entscheidungen selbsttragend sind. Der große Fehler in der Pandemie im politischen System war, dass man Entscheidungen getroffen hat, die nicht mal simuliert haben, dass sie klare Entscheidungen sind. Also, wir haben in Deutschland Lockdowns gehabt, die keine waren. Die Leute sind ja nicht doof, die haben es ja gemerkt. Also, entweder macht man kurze Lockdowns, die richtig Schmackes haben, oder eben nicht. Also, von Dezember 20 bis Februar 21, erinnern Sie sich daran? Das war ein Lockdown, der ist sozusagen stark gewesen. Das hat stark angefangen und hat dann stark nachgelassen, weil man sozusagen immer wieder neue Formen gefunden hat, jemandem, der dagegen geredet hat, entgegenzukommen. Es wäre besser gewesen zu sagen, wir machen keinen Lockdown und machen hier und da und dort ein paar Schutzmaßnahmen. Das ist das große Problem in einer komplexen Gesellschaft, solche Entscheidungen durchzuhalten. Aber noch größer ist das Problem, wenn man die Entscheidung noch nicht mal als Entscheidung so simulieren kann, dass man sie durchhalten kann. Und das produziert Unsicherheit. Ich könnte jetzt noch mehr Beispiele nennen. Das tue ich aus Zeitgründen nicht. Wenn man es formalisieren will, sind es alles Dinge, bei denen wir weniger Latenzschutz haben und dadurch eine erzwungene Beobachtung zweiter Ordnung. Heißt auf Deutsch, weniger Latenzschutz heißt, ich werde auf die Bedingungen dessen hingewiesen, was da passiert. Also, sozialpolitisch ist das, glaube ich, ganz wichtig. Eine der größten Herausforderungen wird sein, dass Menschen durch eigene Arbeit in einer digitalisierten Wirtschaft das Gefühl haben, dass sie zur Wertschöpfung etwas beitragen und von der eigenen Arbeit leben können. Man kann das kritisieren als Arbeitsgesellschaft und Leistungsdruck und so weiter. Aber das kritisieren nur Leute, die W-Besoldung bekommen. Ich kriege sogar noch C-Besoldung, ist für die Altersversorgung nicht schlecht. So, und als krisenhaft und damit als sozusagen korrumpierend für die Entscheidungen, ist gewissermaßen der Beobachter zweiter Ordnung, der beobachtet, wie die beobachten. Jetzt stellen wir fest, wissenschaftliche Beobachtung hängt von Faktoren ab, die die gar nicht kontrollieren können. Um Gottes willen! Mehrheiten lassen sich gar nicht so leicht organisieren, weil man die sachlichen Gründe gar nicht so genau kennt und so weiter. Rechtlich wissen wir nicht, was die richtige Entscheidung ist. Das hat, glaube ich, viele Menschen wirklich verunsichert. Zu sagen, dass es keine eindeutigen Rechtskodizes gibt, weil man unterschiedliche Dinge gleichzeitig lösen musste. Also, Krisenerfahrung heißt, latente Bedingungen werden sichtbar. Und wenn ich jetzt so naiv wäre und würde sagen, das ist jetzt gerade der Fall und war vorher nie der Fall, wäre ich wirklich total naiv. Die Geschichte der Moderne ist voll davon. Wir haben nur so einen zarten Blick in die Vergangenheit. Ihr Historiker*innen, Ihr wisst das natürlich besser. Wir tun so, als sei das so sicher, weil wir so sichere Geschichten darüber erzählen können. Also, wenn man sich alleine die Geschichte der Bundesrepublik mit ihren Konflikten anguckt, dann waren das eigentlich immer Situationen, in denen die latenten Bedingungen der eigenen Existenz in Frage gestellt worden sind. Das gilt für die 68er-Bewegung, das galt für die Wiederbewaffnung, das galt für die Ostpolitik in den 70er Jahren. Das galt vor allem für kulturelle Pluralisierung. Erinnern sich die Älteren noch an Schulpolitik? Debatten, die man mal in den 70er Jahren geführt hat und wie die sich auflösen? Also ich sage das jetzt nicht, weil ich bayerischer Staatsbeamter bin, aber das Bundesland in Deutschland, in dem es die besten Möglichkeiten gibt, über zweite, dritte und vierte Bildungswege sozialen Aufstieg zu ermöglichen, ist Bayern. Und die bayerischen Kultusminister, die haben die Welt in den letzten 50 Jahren bestimmt 60 Mal untergehen sehen, wegen der Pluralisierung der Zugänge und der Kritik am dreigliedrigen Schulsystem. Selbst so kluge Leute wie Hans Mayer haben das gemacht. Das ist eigentlich ganz interessant, dass wir gewissermaßen diese Erfahrung, die wir zurzeit machen, als moderne Erfahrung immer schon kennen und die aktuell natürlich besonders stark sind. Insofern würde ich das für sehr riskant halten, zu sagen, dass wir jetzt in besonders unsicheren Zeiten leben. Abgesehen davon muss man sich fragen: Wo auf der Welt gilt das eigentlich? Also, das gilt schon für uns nicht. Wenn man das, was man so Entwicklung nennt, in vielen Teilen der Welt anguckt, dann ist für viele erstaunlicherweise so eine Idee von Fortschritt viel plausibler, als wir das, die wir uns ja die Fortschrittskritik leisten können, weil die Stromversorgung stabil ist, so formulieren. Also ich hoffe, dass sie stabil bleibt, man soll das ja nicht beschreien. Ich schließe jetzt mit einem Gedanken, der so heißt. Vielleicht muss man Entscheidungsalternativen neu erfinden. Also, das ist jetzt quasi was außerakademisches, wenn man so will, wenn ich als Soziologe versuche, in so Feldern was hinzukriegen. Ich berate zum Beispiel den Bundeswirtschaftsminister, dessen Namen ich nicht nennen möchte. Gerade die Wirtschaftspolitik ist ja stark sozusagen institutionalisiert, in stark institutionalisierten Konflikten. Geht es eigentlich, neue Entscheidungsalternativen zu formulieren? Also quasi das, was man logisch den ausgeschlossenen Dritten nennt, und das nicht nur logisch,akademisch zu machen. Das geht immer. Ein Papier darüber schreiben kann jeder. Aber geht das vor einem Publikum? Also, kommen wir raus endlich aus dieser mehr oder weniger Staatstätigkeit. Das ist so das, was mich im Moment sehr interessiert. Alternative, die ja keine ist, das wissen wir ziemlich genau. Wir wissen ziemlich genau, dass diese Neuentwicklungen von Technologien, die werden weder über das liberal-libertäre funktionieren, noch über das regulierende funktionieren, sondern wahrscheinlich über einen Staat, der an anderer Stelle aktiv wird als vorher. Vielleicht viel stärker als ökonomischer Akteur, als als ökonomischer Regulator. Das sage ich jetzt nicht, weil das so ist, sondern weil das Überlegungen sind, die ich mir mache. Das kann ich jetzt gar nicht begründen. Das hebt die Paradoxien des Entscheidens nicht auf, macht sie aber womöglich produktiv. Vielleicht gibt es nur mehr Rationalität durch vernetzte Beobachter. Die Kybernetik würde das immer behaupten. Wenn es gelingt, das ist das Beispiel vorhin gewesen mit diesen Boards, vernetzte Beobachter miteinander in Beziehung zu setzen und zu sehen, wie sich doch Lösungen dadurch ergeben, dass Leute auf das Gleiche mit unterschiedlichen Mitteln schauen und sich dabei wechselseitig beobachten. Ich geb Ihnen ein letztes Beispiel, dann höre ich auf zu reden. Ich habe mich lange beschäftigt mit Palliativmedizin. Viele, ich glaube vier, DFG Projekte haben wir dazu gehabt. Das ist deshalb interessant, weil das erstens eine hoch unwahrscheinliche Entwicklung des Medizinsystems ist. Ein externes Problem, das ans Medizinsystem herangetragen wurde, hängt viel mit Pluralisierung der Gesellschaft und so weiter zusammen, mit individualisierten Selbstbeschreibungen und, und, und. Und, interessanterweise, konnte es nur gelingen dadurch, dass man vernetzte Beobachter produziert hat, die tatsächlich zum Teil in eingeführten Unterscheidungen des Medizinsystems ein Drittes denken konnten. Wir haben in Deutschland inzwischen das als institutionalisierte Notwendigkeit, dass jeder und jede, die Medizin studieren, in Deutschland einen Schein, hieß das früher, in Palliativmedizin machen müssen, und es einen Rechtsanspruch darauf gibt. Das geht nur, weil bestimmte Unterscheidungen zumindest befragt werden konnten. Für mich ist das so ein Modell für die Herstellung neuer Entscheidungsalternativen, die selber natürlich alle wieder in Schwierigkeiten geraten. Vielen Dank. Das war mein Vortrag. Ein bisschen Literatur, falls Sie was lesen wollen, aus dem ich das zum Teil habe. Und ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.