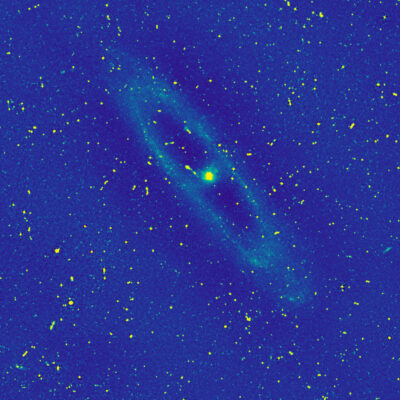Historiker*innen haben seit jeher mit Unsicherheit zu tun. Mit neuen digitalen Methoden tragen sie dazu bei, einen neuen Blick auf den Umgang mit diesem Thema zu werfen.
Wer hat recht: Der Youtuber, der vermeintlich einfache Antworten zu Phänomenen wie der Corona-Pandemie gibt und mehr als 30.000 Likes hat – oder die Wissenschaftlerin, die abwägt, einordnet und verschiedene Quellen nennt? Wie entscheiden wir, was wahr ist? „Ich beobachte hier einen Wandel“, sagt Dr. Silke Schwandt. Sie ist Professorin für Digital History an der Universität Bielefeld.
Das 19. und 20. Jahrhundert war Schwandt zufolge durch eine starke Wissenschaftsgläubigkeit geprägt. Inzwischen spielen auch andere Werte eine Rolle, wenn Menschen einordnen, was für sie sicher und was unsicher ist. „Unser Alltag ist sehr komplex und uns erreichen nahezu ständig neue Informationen. Wir sind inzwischen daran gewöhnt, über Likes zu strukturieren, woran wir glauben.“
Unklare Aussichten können Angst erzeugen
Unsicherheit zieht sich durch den Alltag: Die Tagesschau weist in der Berichterstattung zum Krieg in der Ukraine zum Beispiel darauf hin, dass diese Informationen nicht gesichert sind, weil sie von Kriegsparteien stammen. „Das ist inzwischen wie ein genereller Disclaimer“, sagt Schwandt. „Aber ich bin mir gar nicht sicher, ob das überhaupt entsprechend wahrgenommen wird.“
Oft erzeugt Unsicherheit auch Angst, zum Beispiel mit Blick auf den Klimawandel, auf Krankheiten – oder auch ganz banal bei der Frage, wie teuer Mehl, Benzin und Öl wohl demnächst sein werden. Deshalb wird sie gerne einmal ausgeblendet, zum Beispiel indem Menschen sich an vermeintlich einfachen Antworten orientieren.
Den Umgang mit Unsicherheit vergleichen
Um den Umgang mit Unsicherheit in der heutigen Gesellschaft einzuordnen, kann es helfen, sich anzusehen, wie frühere Gesellschaften das Thema behandelt haben – zum Beispiel im Mittelalter. Zu dem Thema leitet Schwandt ein Teilprojekt im Sonderforschungsbereich 1288 „Praktiken des Vergleichens“. In dem Verbund leitet sie ebenfalls ein Teilprojekt zu digitalen Geisteswissenschaften.
„Was als sicher gilt, ist immer das Ergebnis eines Aushandlungsprozesses“, sagt die Wissenschaftlerin. „Im Mittelalter war das über Autoritäten organisiert.“ Die Orientierung an der Bibel und die Auslegungen der Kirchenväter gaben viel Sicherheit. „Man darf nicht vergessen, dass das Leben im Mittelalter auf das Jenseits hin ausgerichtet war“, sagt Schwandt. Das Diesseits verlor damit ein Stück weit an Bedeutung: Es bestand die Hoffnung auf ein erfülltes Leben nach dem Tod, auch wenn gerade Krankheiten herrschten oder es eine Missernte gab.
Durchspielen, wie plausibel ungesicherte Angaben sind
Allerdings gibt es auch hier wieder Unsicherheiten – und zwar in der Forschung: „Wir müssen uns immer darüber bewusst sein, dass wir nur von einem kleinen Teil der Menschen aus dieser Zeit überhaupt etwas wissen“, sagt die Professorin. Ein Großteil der mittelalterlichen Bevölkerung konnte nicht lesen oder schreiben und somit auch keine eigenen Gedanken zu Papier bringen.
Unsicherheit ist immer wieder ein großes Thema für Wissenschaftler*innen – und das ganz besonders in der Geschichtswissenschaft. Manchmal stehen Forschenden aus einer gewissen Epoche nur wenige Quellen zur Verfügung. „Ich sage gern, dass wir als Historiker*innen Profis darin sind, mit Unsicherheit umzugehen“, sagt Schwandt. Wissenschaftler*innen wägen ab, wie plausibel eine historische Darstellung ist: Was ist wahrscheinlich, was ist logisch, was ergibt sich aus dem Kontext? Das Ergebnis gilt so lange, bis es womöglich eine neue Erkenntnis gibt, die es infrage stellt.
Mit Algorithmen verborgene Muster in historischen Quellen entdecken
In manchen Fällen können Historiker*innen Unsicherheit auch aktiv nutzen. Bislang waren sie darauf angewiesen, Quellen Zeile um Zeile selbst zu deuten. „Nun stehen uns durch die Digitalität neue Methoden zur Verfügung, die auf Algorithmen basieren“, sagt Schwandt. „Damit können wir eine produktive Unsicherheit erzeugen, die uns neue Erkenntnisse ermöglicht.“
Konkret erlauben Algorithmen neue Zugriffsformen auf Quellen: Sie können etwa analysieren, ob es bestimmte Muster in Texten gibt oder welche Wörter und Phrasen besonders häufig miteinander in Verbindung stehen. „Sie können auch vorschlagen, welches Thema ein Text behandelt“, sagt Schwandt.
Einen Haken gibt es aber dabei: „Wir dürfen den digitalen Methoden nicht blind vertrauen und bedingungslos an die Technik glauben“, sagt die Forscherin: „Mit den von der Software erzeugten Daten kaufen wir immer auch neue Unsicherheit ein, bei der wir wiederum gefordert sind, sie einzuordnen.“
Mit neuen Formen an die Öffentlichkeit
Zurück zum gesellschaftlichen Vergleich: Sind die Auslegungen der Bibel mit den heutigen Likes zu vergleichen, wenn es darum geht, wer eine Autorität ist und über wahr und falsch entscheidet? Ein Stück weit, sagt Schwandt – auch wenn beide Gesellschaftsformen nur bedingt miteinander zu vergleichen sind.
Die Frage ist, wie Wissenschaft trotzdem an die Öffentlichkeit treten und sich Gehör verschaffen kann. „Ich denke da zum Beispiel an Youtube-Formate“, sagt Schwandt. „MrWissen2go und Mai Thi Nguyen-Kim haben gezeigt, dass so etwas möglich ist und sehr erfolgreich sein kann. Gerade diese Formate zeigen einen gelungenen Umgang auch mit unsicheren Daten, indem sie auf Quellen hinweisen und eigene Meinung kennzeichnen.“