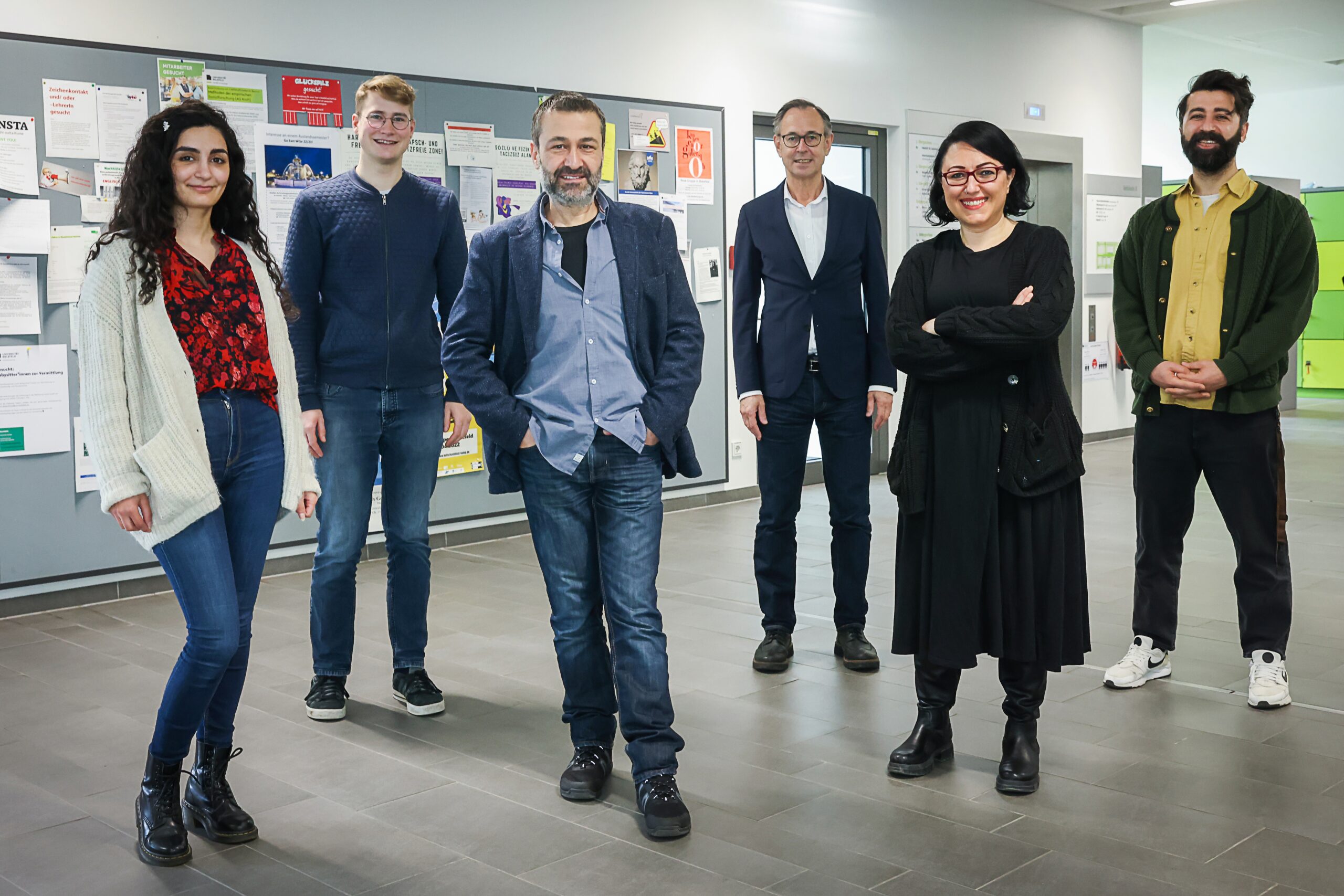Dr. Ekrem Düzen floh aus seiner Heimat, der Türkei, nachdem er seinen Job an der Fakultät für Psychologie an der Universität Izmir verlor. Er hatte eine Friedenspetition unterzeichnet, die die türkische Regierung aufforderte, Militäraktionen in kurdisch besiedelten Gebieten einzustellen, da sie zivile Todesopfer forderten – dies machte es unmöglich, weiterhin seinen Lebensunterhalt in der Türkei zu verdienen. Den gescheiterten Putschversuch in 2016 nutzte die Regierung der Türkei, um die intellektuelle Elite weiter zu verfolgen. Trotz großer Schwierigkeiten gelang es Düzen, rechtzeitig das Land zu verlassen. Heute lebt er in Bielefeld, wo er die Studie TransMIGZ über die türkische Community in Deutschland leitet.
Journalistin Amy Zayed hat mit ihm über die Studie gesprochen, und darüber, ob die Idee dazu mit seiner eigenen Geschichte als gefährdeter Wissenschaftler verknüpft ist.
Amy Zayed: Dr. Düzen, bitte erklären Sie mir doch, worum es in der Studie geht.
Ekrem Düzen: Es geht um die türkische Migrant*innen-Community, die seit Langem in Deutschland lebt. Es gibt viel akademische Literatur zur Geschichte der türkischen Migrant*innen, die meistens als sogenannte Gastarbeiter nach Deutschland gekommen sind. Die Geschichte ist mittlerweile über 60 Jahre alt. In unserer Studie geht es um den sozialen Zusammenhalt aus einer Minderheitsperspektive. Normalerweise wird der Begriff des sozialen Zusammenhalts in der akademischen Literatur eher aus der Mehrheitsperspektive verstanden. Aber mittlerweile werden immer mehr europäische Länder, und insbesondere Deutschland, zu Migrationsländern. In unserem Ansatz geht es nicht um eine Migrationsperspektive, sondern um eine transnationale Perspektive.
Die Heimatländer dieser Menschen sind heutzutage nicht mehr so weit entfernt, wie sie es früher einmal waren. Vor 40, 50 oder 60 Jahren waren diese Menschen total von ihren Heimatländern abgeschnitten. Die waren unerreichbar für sie. Man musste tagelange Reisen antreten und man konnte nicht so einfach mal mit den Menschen in der Heimat kommunizieren. Entweder gab es die Mittel gar nicht oder sie waren einfach viel zu teuer. Sogar Telefonanrufe waren manchmal schwierig oder teuer. In der heutigen transnationalen Zeit ist das Reisen um Längen einfacher. Kommunikation ist auch einfacher. Sie ist nicht nur einfacher, man hält sie praktisch einfach so in den Händen. Dass man seine Leute einfach sehen, hören oder sprechen kann, sind wichtige Merkmale unserer Zeit.
Und genau solche Dinge sind für unsere Studie interessant. Wir versuchen, die transnationale Existenz oder Präsenz dieser Migrationscommunity in Deutschland zu verstehen. Und warum konzentrieren wir uns auf türkische Migrant*innen? Ganz einfach! Weil meine Kolleg*innen und ich alle aus der Türkei stammen. Es ist ein Vorteil, wenn man die Sprache spricht.
Ein anderer Punkt ist, dass die türkische Einwanderungscommunity die größte in Deutschland ist. Jeder 35. Mensch in Deutschland hat türkische Wurzeln. Wenn ich sage, drei Prozent der deutschen Bevölkerung hat türkische Wurzeln, dann klingt das sehr wenig. Wenn ich aber sage, jeder 35. Mensch hat türkische Wurzeln, wird klarer, dass es sich doch um so einige Menschen handelt.
Also machen wir zwei Dinge: Die Existenz der türkischen Community in Deutschland hat eine Art Zwischenposition. Das heißt: Manchmal sagen sie, wir gehören mehr zur Türkei, manchmal sagen sie, wir gehören mehr zu Deutschland, und manchmal sagen sie, wir sind irgendwie beides! Und dann sagen sie manchmal, wir sind nichts von beidem. Unser Ziel ist es, diese Zwischenpositionen dieser Menschen in ihrer eigenen Perspektive, ihren eigenen Worten darzustellen und zu reflektieren. Wir werden mit den Leuten sprechen, Umfragen machen, wir versuchen ihren Identitätsausdruck, ihre Positionen, ihre Zugehörigkeitsprioritäten zu verstehen. Und wir machen das, weil wir glauben, dass die Minderheitsperspektive genauso wichtig ist, wenn nicht sogar noch wichtiger als die Mehrheitsperspektive.
Die Mehrheitsperspektive sieht oftmals die Minderheit als Bedrohung des sozialen Zusammenhalts. Und deshalb ist es interessant herauszufinden, wie die Minderheit zum sozialen Zusammenhalt beitragen kann. Und vielleicht zu zeigen, dass es da gar keine Bedrohung gibt, und falls es eine geben sollte, wäre es spannend herauszufinden, wie man sie verringern kann. Außerdem wäre es gut zu hinterfragen, was eigentlich gut ist an sozialem Zusammenhalt. Sollten wir sozialen Zusammenhalt anstreben? Ist das ein gutes Ziel? Könnte es nicht auch eine friedliche Koexistenz werden? Bauen wir eine deutsche Nation, in der wir die Migrant*innen alle inkludieren? Sollte jede*r sich als deutsch sehen oder sollte man sich seine eigene Identität bewahren?
Zayed: Was ich bei der Recherche so interessant fand, war, dass als die sogenannten Gastarbeiter nach Deutschland kamen, hier in Deutschland anders als in anderen europäischen Ländern sehr wenig getan wurde, um diese Menschen in die Gesellschaft zu integrieren. Diese Menschen hatten eigentlich kaum eine Chance, Deutsch zu lernen oder sich mit Deutschen zu umgeben, weil sie ja die meiste Zeit gearbeitet haben. Die Regierung dachte, die gehen irgendwann eh wieder zurück in ihre Heimat. Als dann die Familien kamen, sagte die erste Generation dann oft: Wir gehen nächstes Jahr zurück, wir gehen in fünf Jahren zurück! Und am Ende gingen sie nicht zurück und bekamen aber dann eine Art Identitätsproblem, denn ihre Kinder hatten angefangen, sich hier heimisch zu fühlen, waren teilweise hier geboren. Und für die zweite und dritte Generation wurde es noch schwieriger. Ihre Verwandten in der Türkei oder sogar ihre Eltern warfen ihnen vor, nicht türkisch genug zu sein, während ihre deutschen Mitschüler*innen, Kolleg*innen etc. ihnen vorwarfen, nicht deutsch genug zu sein. Mich würde einfach sehr interessieren, wie diese psychische Belastung und diese gesellschaftliche Komplexität sich auf die Identität ausgewirkt haben. Wie sehen Sie Ihre Identität? Und wie wirkt sich dieser Identitätsausdruck auf den sozialen Zusammenhalt aus?
Düzen: Sie haben vollkommen recht. Besonders die erste Generation wurde vollkommen allein gelassen. Obwohl sie Deutsch lernen wollten, gab es für sie keine Deutschkurse. Mehr noch, als die Familien kamen, wollten sie Deutschkurse für die Frauen. Aber die deutsche Regierung sah damals keine Notwendigkeit dafür. Irgendwann hat dann aber die deutsche Regierung eingesehen, dass dringend etwas dafür getan werden muss, diese Menschen in die deutsche Gesellschaft zu integrieren.
Zayed: Irgendwann so um 2004.
Düzen: Ja. Es ist wirklich unglaublich, dass die so lang gebraucht haben. Ich meine, besonders in den 70ern und 80ern hatte Deutschland so viele Chancen, die türkische Community in die deutsche Gesellschaft zu integrieren. Und damals waren die türkischen Einwanderer*innen absolut willens mitzumachen. Aber dann hatte ich den Eindruck, dass sich die Haltung der deutschen Regierung ziemlich stark geändert hat und es dann auf einmal hieß: Jetzt müsst Ihr alle ganz schnell ganz viel Deutsch lernen und sprechen. Ihr müsst es sogar zu Hause sprechen mit eurer Familie. Was irgendwie absurd klang, nachdem man sich jahrelang überhaupt nicht darum geschert hatte.
Und dann ist noch etwas passiert. Als die aktuelle türkische Regierung an die Macht kam, änderte sich die Auslandspolitik dramatisch. In 2010 fingen sie an, die türkischen Einwanderer*innen im Ausland Diaspora zu nennen. Aber Diaspora hatte bis damals auch einen sehr negativen Beigeschmack. Es klang so, als ob man über einen Staatsfeind sprechen würde. Oder über Menschen, die nicht zum eigenen Land gehören.
Aber die Regierung eignete sich den Begriff für die Migrant*innen im Ausland zu ihrem Vorteil an, weil sie sahen, dass andere Länder das auch erfolgreich taten. Im Grunde war das einfach politische Taktik, weil man, indem man die türkischen Einwanderer*innen in Deutschland Diaspora nennt, auf diplomatische Weise das Signal nach Deutschland sendet: Behandelt unsere Leute ja nett bei Euch. Auf der anderen Seite hat die türkische Regierung sich dann direkt an die türkische Einwanderungscommunity gewandt und signalisiert, sie sollen sich zwar an die Gesetze ihres Gastlandes halten, ihr Herz aber nur der Türkei schenken. Das hat natürlich diese Zwischenposition, in der sich die türkischen Einwanderer*innen eh schon befinden, noch viel mehr gestärkt, es riss noch mehr an ihnen. Es machte ihre Position noch schwieriger.
Wir versuchen, diese schwierige Zwischenposition zu verstehen. Diese verschiedenen gesellschaftlichen und politischen Strömungen, die an diesen Menschen zerren und versuchen, sie zu beeinflussen. Im Grunde ist das politische Propaganda auf beiden Seiten, die an den Menschen zerrt.
Unabhängig von ihrer Generation bezeichnen wir diese Migrant*innen als Postmigrant*innen. Weil sie auf eine Art Teil von Deutschland sind. Sie sind keine Gastarbeiter*innen mehr. Wir würden diesen Begriff gern in der akademischen Literatur etablieren.
Das andere ist, dass die türkische Community in Deutschland heterogen ist. Deshalb nennen wir sie nicht Türk*innen, sondern Menschen mit türkischem Ursprung. Ein Drittel von diesen Menschen sehen sich auch gar nicht als türkisch. Es gibt Kurd*innen, Zazaki. Es gibt Alewit*innen, Linksorientierte, Aktivist*innen aus verschiedenen politischen und gesellschaftlichen Richtungen, ganz gewöhnliche Bürger*innen, Leute aus allen möglichen gesellschaftlichen Schichten. Arbeiter*innen, Lehrer*innen, Ärzt*innen, Politiker*innen, Menschen mit wirklich allen gesellschaftlichen und kulturellen Hintergründen. Aber das politische Bild von türkischen Menschen ist: Du bist Türk*in, Du bist muslimisch. Aber dieses Klischee sagt nichts aus über meine persönliche Definition des Islam oder wer ich eigentlich bin.
Unser Statement, was wir mit dieser Studie machen wollen, ist, dass man diese Bevölkerungsgruppe nicht als einheitliche Gruppe sehen kann, sondern man muss die Heterogenität und Verschiedenartigkeit dieser Gruppe in Betracht ziehen. Weil es viele Klischees in den Köpfen von sowohl türkischen als auch deutschen Politiker*innen gibt. In der Türkei muss man der konservative, religiöse wertetreue Mensch sein, der der Türkei gegenüber loyal ist, und in Deutschland soll man integrierte*r Bürger*in sein, die*der am besten selbst zu Hause nur Deutsch spricht. Aber die türkische Bevölkerungsgruppe ist keins von diesen beiden Wunschklischees. Sie haben ihren eigenen Stil und wir wollen verstehen, wie sie ihn entwickelt haben, und wie sie ihn ausdrücken.
Wie drücken sie ihre Identität aus? Gar nicht mal so sehr, wie sie ihre Identität sehen, sondern wie sie sie ausdrücken. Wir wollen beiden Seiten sagen: Schmeißt doch endlich Eure veralteten Klischees aus Euren Köpfen und hört auf, sie den Menschen vor die Füße zu schmeißen! Akzeptiert sie als das, was sie sind! Hört Euch die Minderheiten an! Hier habt Ihr Eure Daten! Denn es wird keinen sozialen Zusammenhalt geben, wenn Ihr diesen Minderheiten nicht zuhört. Und das ist im Großen und Ganzen unser Ziel.
Zayed: Wie weit sind Sie bisher mit der Studie gekommen?
Düzen: Wir haben vor etwa einem Jahr angefangen und haben noch etwa 18 Monate vor uns. Wir haben eine Studie in zwei Schritten gemacht. Zuerst gab es ein generelles Screening, in dem wir wirklich alle Daten zusammengetragen haben, die wir gefunden haben. Nach diesem ersten Screening haben wir die Medien, die von türkischen Postmigrant*innen am meisten konsumiert werden, genau unter die Lupe genommen. Nicht, weil wir ihre Nutzungsgewohnheiten verstehen wollten, vielmehr wollten wir verstehen, wie die Türkei, oder besser, wie die türkische Regierung sie anspricht. Aber andererseits auch, wie Deutschland sie anspricht.
Im Moment analysieren wir das Klischee der Postmigrant*innen in der Vorstellung der türkischen Regierung. Und andererseits analysieren wir auch das deutsche Bild der Einwanderer*innen in den Köpfen der Deutschen. Um zu zeigen, dass die eine Seite von ihnen erwartet, sich zu integrieren, während die andere will, dass sie der Türkei gegenüber loyal bleiben.
Der zweite Schritt ist eine Archivstudie. Denn vor 2010, bevor diese ganze Diaspora-Regelung in Kraft trat, haben alle vorherigen Regierungen die Einwanderer*innen gleich behandelt. Aber die gegenwärtige Regierung hat sich ganz besonders darauf fokussiert, dass sie der Türkei gegenüber loyal bleiben. Das machen die innenpolitisch genauso. Denjenigen, die auf ihrer Seite stehen, geben sie alles und behandeln diejenigen, die gegen sie sind, schlecht. Und damit spalten sie die gesamte türkische Gesellschaft.
Zayed: Woher kam die Idee zu der Studie? Gerade auch unter dem Aspekt, dass Sie selbst gar keine Erfahrung in der Migrationsforschung haben. Denn eigentlich sind Sie ja Psychologe.
Düzen: Am Anfang sollte ich auch nur als Berater fungieren. Aber dann stieg ein wichtiger Teamkollege aus und ich bin eingesprungen. Ich war der, der am leichtesten verfügbar war, den sie auf die Schnelle finden konnten. Ich habe viel Erfahrung in der Arbeit mit Eltern und Kindererziehung. Ich habe für die Unicef gearbeitet und habe Trainingsprogramme, Datenmaterial und Studien entwickelt. Und dann habe ich viel mit Jugendarbeit gemacht. Kurz bevor ich nach Deutschland kam, habe ich mich für Jugendmobilität und Jugendarbeit im Balkan eingesetzt. Ich hatte also die Idee der Transnationalität schon lange im Kopf, wenn auch vor allem aus der Perspektive der jungen Menschen. Und so bin ich nun an dieses Projekt gekommen.
Zayed: War das Projekt schon vor Ihrer Ankunft in Deutschland geboren oder ging es erst an den Start, als Sie schon da waren? Und hat es in irgendeiner Form mit Ihrer eigenen Fluchtgeschichte zu tun oder Ihrer eigenen transnationalen Reise?
Düzen: Nein, das Projekt startete, als ich schon drei Jahre lang in Deutschland war. Aber ich fange mal von vorne an. Im Januar 2016 gab es eine Friedenspetition in der Türkei, die ich unterschrieben habe. Und jeder Mensch, der diese Petition unterschrieben hat, wurde entweder aus seiner Position entlassen oder von der Regierung befragt. Ich war der Zweite, der aus seiner Position als Wissenschaftler entlassen wurde, allein aufgrund dieser Unterschrift. Naja, und dann kam ja der fehlgeschlagene Militärputschversuch im Juli. Und den hat die Regierung zum Anlass genommen, noch mehr Akademiker*innen zu entlassen. Und daraufhin sind Hunderte von ihnen nach Deutschland geflohen und ich bin einer von ihnen.
Zayed: Aber warum gerade Bielefeld? Sonst reißen sich alle um Köln oder Berlin. Warum gerade in Ihrem Fall Bielefeld?
Düzen: Wegen meines Mentors, dem Direktor des IKG. Ich kannte ihn nicht persönlich. Aber einer meiner Kollegen verwies mich an Andreas Zick und der hat mir geraten, auf der Stelle meinen Hintern aus der Türkei zu schaffen und hierher zu kommen. Für die Entscheidung habe ich genau eine halbe Stunde gebraucht. Im Grunde hatte ich Glück, in Bielefeld zu landen. Mein Mentor hält sein Wort und hat unsere Position von Anfang an verteidigt, tut es bis heute und wird es wahrscheinlich auch bis zum Ende tun. Und dann wurde ich sozusagen die Verbindung für andere Akademiker*innen, die Hilfe brauchten. Das ist, denke ich, der schönste Teil meiner Geschichte. Wir haben hier diese großartige Möglichkeit, den tollen Job zu machen, den unser eigenes Land uns verwehrt hat, also wollen wir ihn auch richtig gut machen!