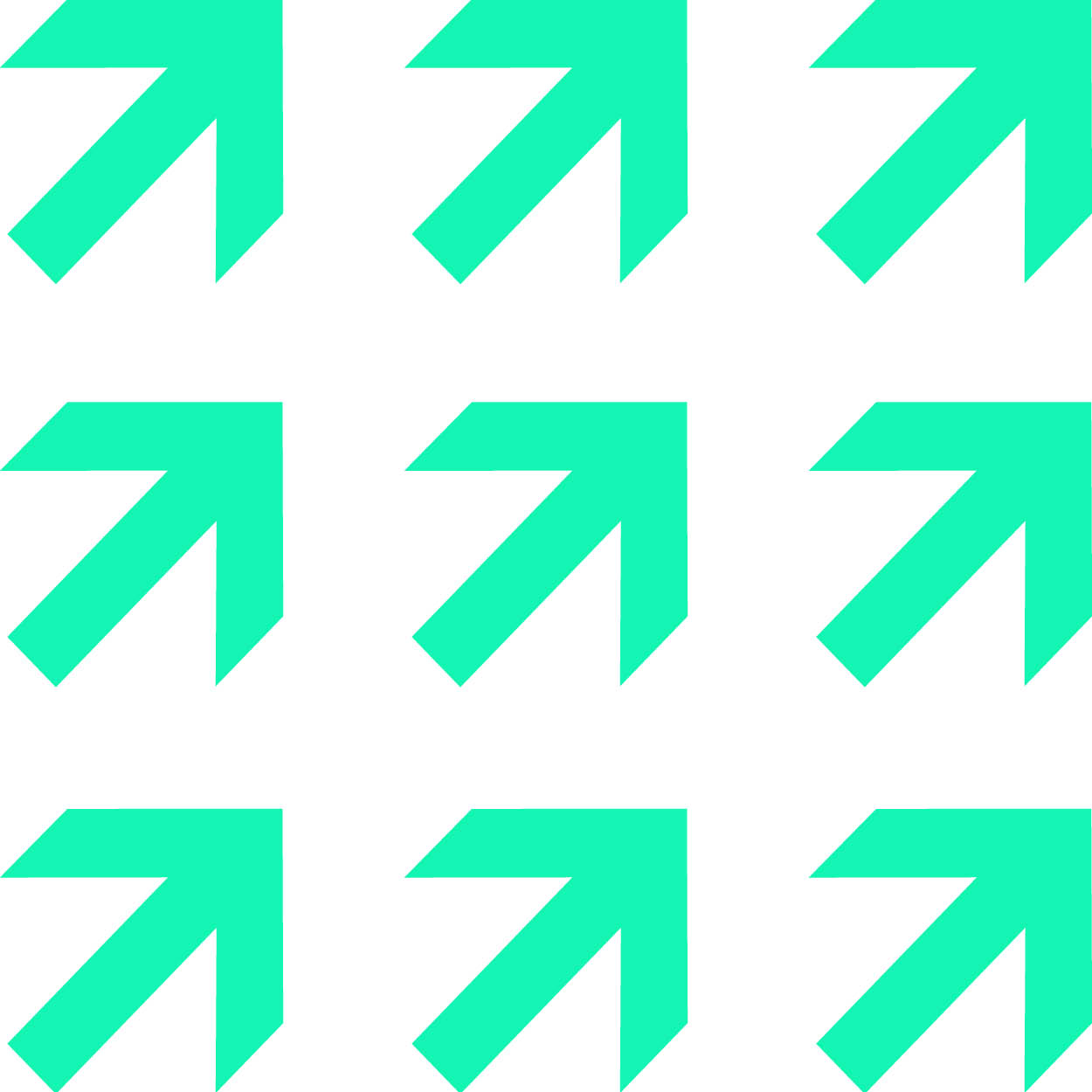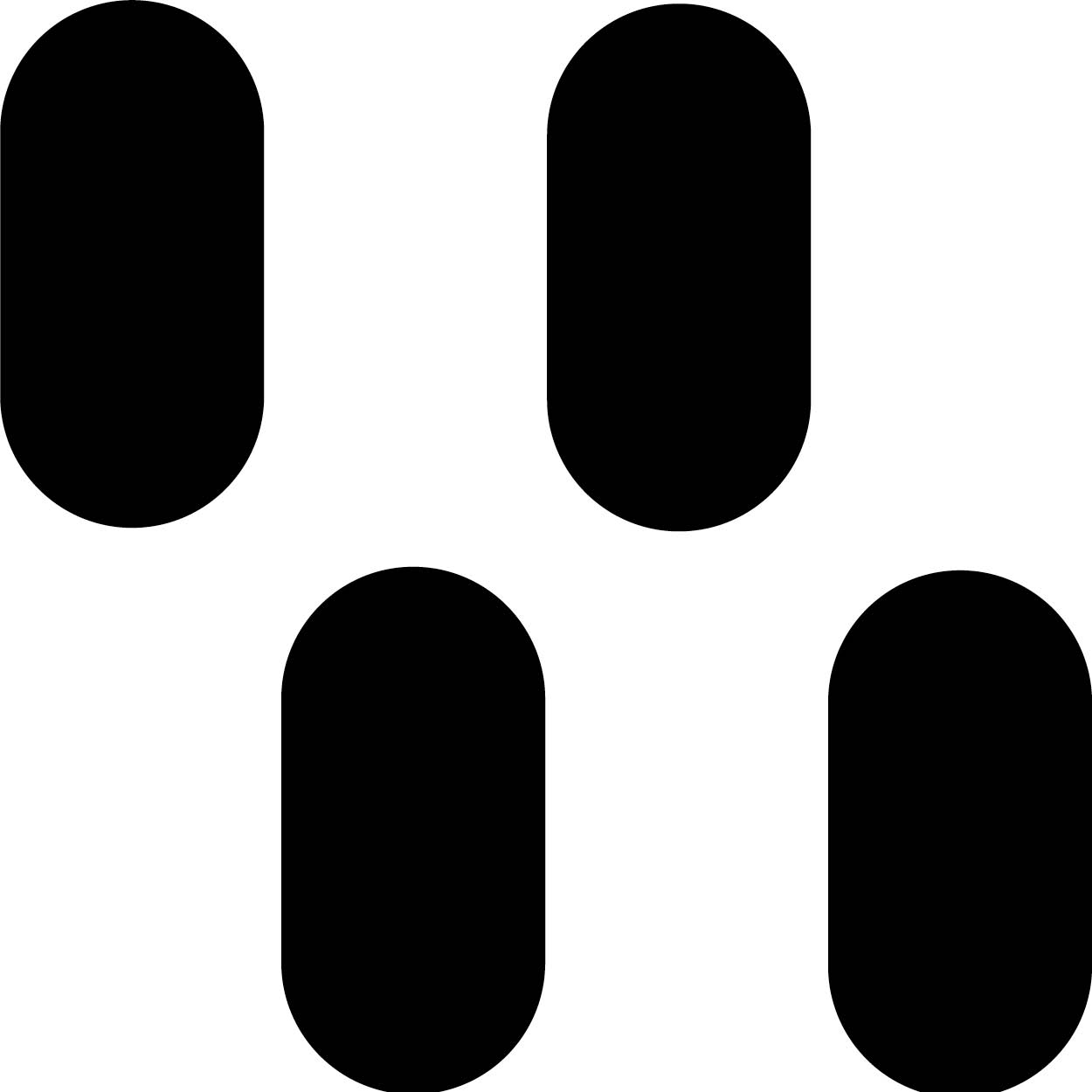Clever, langweilig, extravagant, pingelig: Solche Wörter oder andere Inhalte zu lernen und zu erinnern, fällt leichter, wenn die Lernsituation in einen sozialen Kontext eingebettet ist – wenn sich die Begriffe also auf einen selbst beziehen und die jeweilige Person annimmt, dass sie von jemand anderen kommen. „Auf den ersten Blick ist das vielleicht gar nicht so verwunderlich, aber wir konnten diesen Effekt in Versuchen mit Hirnstrommessungen nun tatsächlich nachweisen“, sagt Professorin Dr. Johanna Kißler von der Fakultät für Psychologie und Sportwissenschaft an der Universität Bielefeld. Sie hat die Studie betreut, die am Institut CITEC der Universität Bielefeld entstanden ist und jetzt in der Fachzeitschrift Scientific Reports erscheint. Die anderen Studienautor*innen forschen inzwischen an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster.
Die neu veröffentlichte Studie ist Teil einer Serie von Untersuchungen. Ausgangspunkt dieser Serie war es, die Effekte von virtueller Kommunikation auf Gehirn- und Verhaltensreaktionen zu untersuchen. „Vieles spielt sich inzwischen – nicht erst seit Corona, aber dadurch verstärkt – virtuell ab“, damit erklärt Erstautor Dr. Sebastian Schindler von der Universität Münster den Fokus auf diese Kommunikationsform. Die Forschenden wollten herausfinden, welchen Einfluss der soziale Kontext auf die Gedächtnisleistung hat und ob es sich dabei um messbare Langzeiteffekte handelt.
Dafür teilten sie die Versuchspersonen in drei Gruppen ein. In der ersten sollten die Teilnehmenden vor einer Kamera etwas über sich erzählen. Zuvor wurde ihnen gesagt, dass sich währenddessen im Nebenraum jemand einen Eindruck über sie bildet und daraufhin Adjektive aussucht, die ihre Persönlichkeit beschreiben sollen und die ihnen anschließend auf einem Monitor präsentiert werden. Die Versuchspersonen konnten dann per Tastendruck entscheiden, ob das jeweilige Wort auf sie zutrifft oder nicht. „Wichtig hierbei ist, dass die Adjektive, also das Feedback, das die Versuchspersonen erhielten, Fake waren“, sagt Professorin Johanna Kißler. „Alle bekamen die gleichen Wörter.“ Auch den Personen der zweiten Gruppe wurden diese Begriffe gezeigt, allerdings mit der expliziten Aufforderung, sie zu lernen und dem Hinweis, dass es darüber eine Woche später einen Test geben würde. Das wurde den Teilnehmenden der dritten Gruppe nicht mitgeteilt. Sie sahen lediglich die Adjektive auf dem Monitor und sollten entscheiden, ob das Wort für sie eher abstrakt ist oder ob sie es als selbstbeschreibend empfinden. Während des Versuchs maßen die Forschenden die Hirnströme der Personen in allen drei Gruppen.
Forschende weisen langanhaltenden Effekt nach
„So konnten wir nachweisen, dass ein sozialer Kontext einen riesigen Effekt auf die Gehirnantworten hat“, fasst Schindler zusammen. „Wir konnten sehen, dass in der Feedbackgruppe die Hirnantworten schnell hoch gingen, bei den Personen der expliziten Lerngruppe aber erst spät. Das interpretieren wir so, dass Lernen dann ein mühevoller Prozess ist, wenn der Lernstoff einen nicht selbst betrifft. Ist etwas für eine Person hingegen sozial relevant, lernt sie quasi automatisch.“
In einem weiteren Schritt untersuchten die Psycholog*innen, ob es sich um langanhaltende Effekte handelt. Dafür wurden den Versuchsteilnehmenden nach einer Woche erneut Eigenschaftswörter gezeigt und sie mussten angeben, ob sie diese im ersten Versuch gesehen haben. Das Ergebnis: Die Personen aus der ersten Gruppe erkannten das Material viel besser wieder als jene aus den beiden anderen Gruppen, obwohl sie nichts von dem Test wussten. Einen Preis hat die bessere Gedächtnisleistung der Feedbackgruppe allerdings: „Ihre Antworten waren sehr viel stärker ins Positive verzerrt“, erklärt Johanna Kißler. „Die Teilnehmenden aus dieser Gruppe haben also gedacht, dass sie im ersten Teil des Experiments mehr positives Feedback bekommen haben als es tatsächlich der Fall war.“
In zweiter Phase waren Versuchspersonen über Vortäuschung informiert
Bemerkenswert sei das Ergebnis auch vor dem Hintergrund, dass die Forschenden den Personen, die ein Feedback erhielten, nach dem Ende der ersten Versuchseinheit mitteilten, dass dieses vorgetäuscht war. „Obwohl ihnen also klar war, dass die Adjektive rein zufällig und nicht persönlichkeitsbeschreibend waren, haben sie eine Woche später trotzdem die besten Ergebnisse bei deren Wiedererkennung erzielt“, sagt Sebastian Schindler. Dass es nicht daran gelegen haben kann, dass zu den Eigenschaftswörtern ein Selbstbezug hergestellt wurde („Trifft das Adjektiv auf mich zu?“), zeigt der Vergleich mit der dritten Gruppe: Beim Wiedererkennungstest nach einer Woche schnitt diese am schlechtesten ab. „Wenn etwas als sozial relevant wahrgenommen wird, hat dies also einen positiven Einfluss aufs Lernen“, erläutert Kißler. „In unserer Studie erwies sich die Bewertung durch eine andere Person als entscheidender Faktor – obwohl diese nicht einmal real war.“
Relevant sind die Ergebnisse der Studie, die der bis 2019 laufende Exzellenzcluster Kognitive Interaktionstechnologie (CITEC) finanziert hat, unter anderem für den Bildungsbereich, denn: „Wir konnten zeigen, dass Lernen besser funktioniert, wenn es sozial kontextualisiert ist. Inhalte, die so gelernt werden, sind länger haltbar“, sagt Schindler.
Originalveröffentlichung:
Sebastian Schindler, Ria Vormbrock, Johanna Kißler: Encoding in a social feedback context enhances and biases behavioral and electrophysiological correlates of long-term recognition memory. Scientific Research, https://doi.org/10.1038/s41598-022-07270-9, online veröffentlicht am 28. Februar 2022.