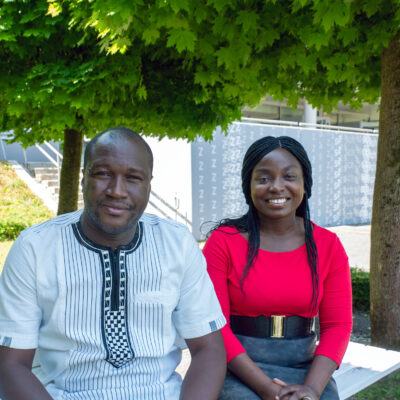Wie verändert sich das Klima in den Amerikas? Wie gut gelingt es der Politik, Naturkatastrophen zu managen – und wer leidet besonders darunter? Mit solchen Fragen befasst sich Professorin Dr. Eleonora Rohland. Sie ist Direktorin des Center for InterAmerican Studies und Professorin für Verflechtungsgeschichte der Amerikas in der Vormoderne.
Mehr Starkregen, mehr Wirbelstürme, mehr Dürren
Das Klima in den Amerikas unterliegt starken Schwankungen, die insbesondere mit der Meeresströmung vor der Westküste Südamerikas und den jeweiligen Wassertemperaturen zusammenhängen. In manchen Phasen steigt die Wassertemperatur vor der Westküste Südamerikas an. Man bezeichnet dieses Phänomen auch als El Niño. „Das verändert atmosphärische Strömungen, die unter anderem zu starken Regenfällen in Ländern wie Peru und Chile führen“, sagt Rohland. Das umgekehrte Phänomen, bei dem das Wasser vor der Küste kälter als sonst ist, wird als La Niña bezeichnet – und bedingt in der Folge unter anderem eine starke Trockenheit in Ländern wie Peru und eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für aktive Hurrikansaisons im Atlantik.

„Wir wissen, dass es solche Schwankungen seit mehreren Tausend Jahren gibt“, sagt die Professorin. Wissenschaftler*innen gehen allerdings davon aus, dass der Klimawandel diese eigentlich natürlichen Effekte verstärkt – mit weitreichenden Folgen. „Damit hängen zum Beispiel die heftigen Waldbrände im Westen der USA in diesem Jahr zusammen, weil es dort extrem trocken war“, sagt Professorin Rohland. Es ist darüber hinaus davon auszugehen, dass extreme Wetterereignisse in den Amerikas zunehmen werden – also zum Beispiel Starkregen, Stürme oder Dürren. „Es deutet zudem alles darauf hin, dass Wirbelstürme stärker werden.“
Unterschiedliche Bestrebungen zum Klimaschutz
Spätestens seit dem UN Earth Summit von Rio im Jahr 1992 haben sich die meisten Staaten in den Amerikas dazu verpflichtet, den Ausstoß von Treibhausgasen zu reduzieren. Die Ziele wurden im 1997 beschlossenen Kyoto-Protokoll festgehalten. Der damalige US-Präsident Bill Clinton unterschrieb das Protokoll – der US-Senat weigerte sich allerdings, es zu ratifizieren. Auf Clinton folgte Präsident George W. Bush, der sich ebenfalls gegen das Kyoto-Protokoll aussprach. Präsident Barack Obama setzte sich schließlich 2015 stark für das Klimaabkommen von Paris ein, das als Meilenstein für den Klimaschutz galt. Präsident Donald Trump kündigte wiederum 2017 an, aus dem Abkommen austreten zu wollen.
Insbesondere in Lateinamerika waren viele Länder empört über diesen Schritt von Trump – viele von ihnen hatten sich über Jahre für ein globales Klimaabkommen eingesetzt. „Allerdings sind die Länder in Bezug auf ihre Klimapolitiken natürlich extrem heterogen“, sagt Eleonora Rohland. So gilt beispielsweise Costa Rica als Vorreiter – das Land hatte angekündigt, bis 2021 klimaneutral sein zu wollen und die Elektromobilität auszubauen. „Brasilien setzt hingegen seit dem Wahlsieg von Jair Bolsonaro wieder deutlich stärker auf fossile Energien“, sagt Rohland. Insgesamt sei darüber hinaus in einigen Ländern in den Amerikas, allen voran Venezuela und Brasilien, zu beobachten, dass sie stark darauf setzten, Rohstoffe wie Öl zu exportieren, um damit ihre Sozialsysteme auszubauen – dies allerdings auf Kosten der Umwelt und indigener Bevölkerungen.
Unterschiedliche historische Verantwortung
In vielen Staaten in den Amerikas haben sich zivilgesellschaftliche und indigene Gruppierungen wie auch NGOs zum Kampf gegen den Klimawandel und für Klimagerechtigkeit zusammengeschlossen. Trotzdem hat die internationale Schüler*innenbewegung Fridays for Future laut Rohland bislang weder in Nord- noch in Südamerika eine ähnliche Schubkraft entwickelt wie in Europa. Das hängt zum einen mit dem extrem unterschiedlichen Status der einzelnen Länder im Hinblick auf den Ausstoß von CO2 und die historische Verantwortung für den globalen Klimawandel zusammen. „Und zum anderen liegt es auch daran, dass in den lateinamerikanischen Ländern andere Fragen häufig drängender für Menschen sind.“ Zum Beispiel: Armut, Gewalt, gesellschaftliche Ungleichheit oder Konflikte rund um Drogen- und Bandenkriminalität.
Auch in den USA sind zum Beispiel die NGOs 350.org und Aavaz stark, die sich für Klimaschutz einsetzen. „Eine Bewegung ähnlich wie die Fridays for Future bei uns nehme ich allerdings auch dort bislang nicht wahr“, sagt Eleonora Rohland, Mitgründerin und -organisatorin der Lectures for Future Bielefeld. Bei der interdisziplinären Vortragsreihe geht es um das Thema „Der Mensch in einer begrenzten Umwelt.“
Nicht alle leiden gleich stark unter Naturkatastrophen
Wenn sich Naturkatastrophen in den Amerikas ereignen, sind nicht alle Menschen gleichermaßen davon betroffen. Rohland hat sich mit der US-amerikanischen Stadt New Orleans von ihrer Gründung 1718 bis zum Hurrikan Katrina beschäftigt, der die Stadt 2005 teils zerstörte und überflutete. In Louisiana wurde 2004 von der staatlichen Katastrophenbehörde FEMA eine Katastrophenübung mit dem Namen „Hurricane Pam“ durchgeführt – und trotzdem versagte das Management 2005. „DieAuswirkungen des Sturms wurden durch die zu späte und ungenügende Reaktion verschiedener Behörden erheblich verschlimmert“, sagt Rohland.
Einige Bevölkerungsgruppen traf die Katastrophe stark. „Unter den Überflutungen litten insbesondere die in den USA durch systemischen Rassismus benachteiligten People of Color“, sagt die Historikerin. Einer der Gründe: Die Stadtteile, in denen hauptsächlich Afro-Amerikaner*innen leben, befinden sich oft in geografisch tiefer liegenden und somit hochwassergefährdeten Teilen der Stadt. „Ein Teil der schwarzen Bevölkerung besaß kein Auto und konnte deshalb nicht aus der Stadt flüchten“, sagt Rohland. Nach der Überflutung fehlte vielen zudem das Geld, um die beschädigten Häuser wieder instand zu setzen. „Es sind somit meist historisch gewachsene, sozioökonomische Faktoren, die insbesondere People of Color und indigene Bevölkerungen in den Amerikas besonders für Naturkatastrophen verwundbar machen.“
Dieser Artikel stammt aus „BI.research“, dem Forschungsmagazin der Universität Bielefeld. Hier gibt es die neue Ausgabe des Magazins.