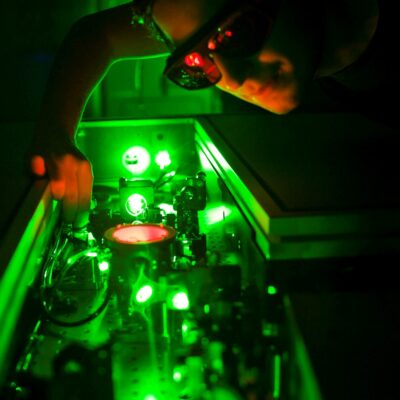Am 23. Mai 1949 wurde das, vom Parlamentarischen Rat beschlossene, Grundgesetz verkündet. Dieses Dokument bestimmt die Grundlagen für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit und markierte einen Wendepunkt in der deutschen Geschichte. Zum 75. Jubiläum gibt die emeritierte Bielefelder Professorin Gertrude Lübbe-Wolff, ehemalige Richterin am Bundesverfassungsgericht, im Interview eine fachliche Einschätzung zur Bedeutung des Grundgesetzes für die Bundesrepublik, aber auch zu zukünftigen Aufgaben und wie sich eine wandelnde Gesellschaft immer wieder als Herausforderung für das Grundgesetz herausstellt.

© Birgit Pichler
Die Rechtswissenschaftlerin Gertrude Lübbe-Wolff war bis zu ihrer Emeritierung 2018 Dozentin für Öffentliches Recht an der Universität Bielefeld und von 2002 bis 2014 Mitglied des zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts.
Welche Bedeutung hat das Grundgesetz Ihrer Meinung nach für die heutige deutsche Gesellschaft und für die Rechtsprechung?
Das Grundgesetz ist die Grundordnung unseres Zusammenlebens, vor allem die Grundordnung für das gesamte Rechtssystem, von dem alle unsere Lebensbedingungen entscheidend abhängen – die Gestalt und Funktionsfähigkeit unserer Demokratie, die Reichweite unserer Freiheiten, unsere Gleichberechtigung, unser Schutz vor Diskriminierung, die Erzeugung von Wohlstand durch Ermöglichung von Kooperation in gesicherten rechtlichen Formen und durch den Schutz von Eigentums- und Freiheitsrechten, aber auch die Begrenzungen solcher Rechte zum Schutz von Umwelt, sozialen Belangen und so fort.
Nicht zuletzt gewährleistet das Grundgesetz die Unabhängigkeit der Gerichte. Ohne die stünde alles Recht nur auf dem Papier. Für die Gerichte ist all das – das Grundgesetz und die Gesetze und sonstigen Regeln, die ihm gemäß zustande gekommen sind – die Grundlage ihrer Rechtsprechung.
Seit der Verabschiedung des Grundgesetzes vor 75 Jahren hat sich die deutsche Rechtsprechung immer wieder mit neuen Herausforderungen konfrontiert gesehen. Wie würden Sie die wichtigsten Meilensteine oder Entwicklungen im Bereich des öffentlichen Rechts seitdem beschreiben?
In der Frühzeit der Bundesrepublik ging es zunächst einmal darum, den Staat, den das Grundgesetz konstituierte, überhaupt aufzubauen und zu stabilisieren, auch das Land wirtschaftlich wieder aufzubauen, alle möglichen Kriegsfolgen zu bewältigen – unter anderem den Zustrom Millionen von Flüchtlingen und Vertriebenen –, die volle staatliche Souveränität wiederzugewinnen, sich wieder in die Staatengemeinschaft einzugliedern. Und dann war da die Daueraufgabe des Umgangs mit der deutschen Teilung. Die war ja mit dem Grundgesetz fürs erste besiegelt, aber das Grundgesetz enthielt auch den Auftrag, auf die Wiedervereinigung hinzuwirken.
Als die dann endlich möglich wurde, war das eine ungeheure Herausforderung, auch für die Rechtsprechung. Die Geschichte der Europäischen Integration und der sonstigen Internationalisierung ist ebenfalls immer wieder mit Herausforderungen für die Rechtsprechung verbunden gewesen. Und dann gab es die bekannten politischen Entwicklungen, Krisen und Herausforderungen wie den Terrorismus der 70er Jahre, neue Techniken, Finanzkrisen, Kriege und neue Flüchtlingsströme, kürzlich die Corona-Pandemie, und große Umweltprobleme, schon in der 70er- und 80er-Jahren, und jetzt, nachdem wir viel zu spät reagiert haben, besonders drängend: das Problem des Klimawandels.
Mit vielen der zurückliegenden Herausforderungen sind wir einigermaßen gut fertiggeworden. Aber die Häufung von Krisen in jüngerer Zeit ist schon besorgniserregend, und wenn es uns nicht gelingt, den Polarisierungstendenzen entgegenzuwirken, die sich daraus ergeben, und die notwendigen Veränderungen sozialverträglich zu gestalten, ist es nicht wahrscheinlich, dass auch diesmal alles passabel ausgeht.
Die deutsche Gesellschaft hat sich in den letzten 75 Jahren stark verändert. Inwiefern hat das Grundgesetz mit diesen Veränderungen Schritt gehalten?
Erstens ist es ja oft geändert worden, fast siebzig Mal. Und es hat auch viele Anpassungen durch Auslegung gegeben. Mit der Feststellung, dass das grundrechtlich geschützte allgemeine Persönlichkeitsrecht auch die Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme umfasst, ist zum Beispiel der Grundrechtsschutz an technische Entwicklungen angepasst worden, von denen die Väter und Mütter des Grundgesetzes noch keine Ahnung hatten.
Und natürlich ändert sich die Auslegung des Grundgesetzes auch mit den Veränderungen der gesellschaftlichen Wertvorstellungen. In den Fünfzigerjahren hat das Bundesverfassungsgericht es noch verfassungsmäßig gefunden, dass homosexuelle Handlungen zwischen Männern unter Strafe gestellt waren. Seit der Jahrtausendwende hat es dagegen mehrfach beanstandet, dass homosexuelle Lebensgemeinschaften, beispielsweise beim Steuersplitting, anders behandelt wurden als die traditionelle Ehe zwischen Mann und Frau. Dem berühmten amerikanischen Verfassungsrechtler Paul Abraham Freund, dessen Verfassungsrechtsvorlesung ich 1974 in den USA gehört habe, wird der schöne Satz zugeschrieben, der Oberste Gerichtshof der USA sollte niemals vom Wetter des Tages beeinflusst sein, aber unvermeidlich sei er beeinflusst vom Klima seiner Zeit. So ist es, und dasselbe gilt natürlich für das Bundesverfassungsgericht.
Das Grundgesetz wurde als vorläufige Verfassung nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffen. Inwiefern spiegelt sich diese historische Situation noch heute in der Rechtsprechung wider?
Durch die Wiedervereinigung Deutschlands am 3. Oktober 1990 hat das Grundgesetz seinen Charakter als provisorische Grundordnung für den Westteil Deutschlands verloren. Diese Wiedervereinigung ist gemäß dem früheren Artikel 23 des Grundgesetzes durch Beitritt der DDR zur Bundesrepublik erfolgt. Aber es gibt immer noch den Artikel 146, der ursprünglich, alternativ zum Beitritt, die Möglichkeit der Wiedervereinigung auf der Grundlage einer ganz neu beschlossenen gemeinsamen Verfassung vorsah.
Heute besagt er, in etwas veränderter Form, dass das Grundgesetz, das „nach Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands für das gesamte deutsche Volk gilt“, seine Gültigkeit an dem Tage verliert, „an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist.“ Dieser Artikel könnte vielleicht einmal eine Rolle spielen, wenn es zur Umwandlung der Europäischen Union in einen Staat käme. Das, und der damit verbundene Verlust der souveränen Staatlichkeit der Bundesrepublik Deutschland, wäre nämlich nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts nicht per Verfassungsänderung zulässig, sondern allenfalls durch einen neuen Akt der Verfassungsgebung, also auf dem Weg des Art. 146 GG. Aber das ist eine theoretische Möglichkeit, die sich jedenfalls nicht in absehbarer Zeit realisieren wird.
Mit Blick auf die Zukunft: Welche Herausforderungen sehen Sie für das deutsche Rechtssystem im Allgemeinen in den kommenden Jahren?
Ich habe ja schon die Häufung von Krisen in letzter Zeit und die damit verbundenen politischen Risiken erwähnt. Die geopolitischen Entwicklungen, die wachsenden Spannungen zwischen den Großmächten, sprechen nicht dafür, dass wir ruhigeren Zeiten entgegengehen. Und ich nehme an vielen, zum Teil ganz alltäglichen Punkten Indizien dafür wahr, dass wir in Deutschland in einer Weise, die für die Zukunft unseres Wohlstands und auch für unseren Sozialstaat bedenklich ist, an Leistungsfähigkeit verlieren.
Pünktliche Züge fahren nicht mehr in Deutschland, sondern in Italien und in Spanien – in der Schweiz natürlich sowieso. Bauprojekte ziehen sich auf absurde Weise hin, da müssen wir nicht bis nach Stuttgart oder Berlin gucken. Und so fort, ich könnte jetzt noch eine lange Liste weiterer Punkte aufmachen. Die Herausforderungen, die sich daraus ergeben, betreffen natürlich viele Bereiche, nicht nur das Rechtssystem, aber eben auch dieses. Zum Glück begegne ich, auch an unserer Uni, neben der einen oder anderen Verpeiltheit und Abgehobenheit von den Realitäten, so vielen engagierten und tüchtigen jungen Leuten, und sehr viel mehr sozialer Kompetenz, als in meiner Generation verbreitet war. Das macht mich dann doch optimistisch.

© picture alliance / akg-images

© Birgit Pichler